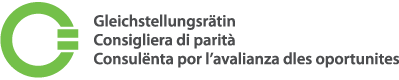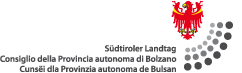News
Plenarsitzung – Siegesdenkmal (2), SüdtirolPass für Rettungsdienst-Freiwillige, Arbeitsintegration
Anträge von Süd-Tiroler Freiheit, Team K und Grünen
Am Mittwochnachmittag (5. November 2025) wurde die erste November-Sitzungsfolge 2025 des Südtiroler Landtages mit der am Vormittag begonnenen Behandlung des Begehrensantrags Nr. 42/25 Faschistische Denkmäler sind keine Mahnmale - das sogenannte Siegesdenkmal gehört ins Museum! (eingebracht von den Abg. Knoll, Atz, Rabensteiner und Zimmerhofer am 14.10.2025; Ersetzungsantrag vom 28.10.2025) fortgesetzt: Der Landtag möge beschließen:
1. Der Südtiroler Landtag verurteilt die Zurschaustellung faschistischer Symbole und Botschaften und hält fest, dass vom sogenannten Siegesdenkmal in Bozen bis heute eine ideologische Botschaft ausgeht, die die Verbrechen des Faschismus verherrlicht und die Südtiroler beleidigt.
2. Der Südtiroler Landtag distanziert sich von jeglichen Versuchen, die Symbolkraft des sogenannten Siegesdenkmals als entfaschistisiertes Kulturdenkmal zu verharmlosen oder als Mahnmal für den Frieden zu reinterpretieren, weil es dafür schlicht die äußeren Kriterien nicht erfüllt.
3. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung dazu auf, sämtliche Sanierungsvorhaben des sogenannten Siegesdenkmals einzustellen.
4. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung dazu auf, das sogenannte Siegesdenkmal abzutragen und Teile davon in einem Museum für Zeitgeschichte auszustellen, wo seine Geschichte wissenschaftlich und frei von ideologischen Vorgaben für die Allgemeinheit aufbereitet wird.
5. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Verteidigungsministerium und die Alpini auf, Gedenkveranstaltungen und Paraden vor Denkmälern und Symbolen des Faschismus zu unterlassen.
6. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, die im Innenhof des „Comando truppe alpine“ in Bozen befindliche Cäsarstatue, deren Sockel mit den faschistischen Liktorenbündeln flankiert ist, sowie alle übrigen im Besitz des italienischen Staates befindlichen Denkmäler des Faschismus in Südtirol zu entfernen und gegebenenfalls einige bzw. Teile davon einem Museum für Zeitgeschichte zur Verfügung zu stellen.
7. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Verherrlichung und Relativierung des Faschismus, etwa in Form des römischen Grußes, des Verkaufes von faschistischen Devotionalien (z.B. Mussoliniwein) sowie die Zurschaustellung von faschistischen Symbolen (z.B. „fiamma tricolore“), die Verbreitung von faschistischen Botschaften und die Verwendung von faschistischen Namen konsequent verboten und geahndet werden.
In der Fortsetzung der Debatte unterstrich LRin Ulli Mair u.a., dass die Historisierung des Siegesdenkmals keinesfalls geglückt sei. Das Dokumentationszentrum sei häufig geschlossen, die erklärenden Tafeln seien kaum wahrnehmbar. Wenn sie sich ein tatsächlich historisiertes Denkmal vorstelle, dann würde das für Südtiroler und Gäste klar vermitteln, warum die Stadt Bozen heute so sei, wie sie sei. Die Forderung nach einem Abriss würde wenig Erfolg haben, insbesondere wenn man sich vergegenwärtige, dass linke Politiker und Historiker das Denkmal verteidigten. Ein Abriss sei eine symbolische Maximalforderung - im Wissen, dass damit nichts weitergehen werde. Auch vor dem letzten Teil des Antrages mit der Forderung einer Abänderung des Strafrechts warne sie. Punkt 1 und 2 werde sie unterstützen.
Hannes Rabensteiner (Süd-Tiroler Freiheit) sprach u.a. davon, dass es sich für ihn hier nicht um ein Mahnmal, sondern um ein Schammal handle. Würde man irgendwo ein Hakenkreuz haben, wäre es dann auch für alle egal? Man traue es Italien nicht zu, der Sache nachzugehen, und ein faschistisches Denkmal abzutragen - das sei traurig. Wo seien die linksradikalen Stimmen? Es wäre sinnvoll, eine breite Mehrheit für den Antrag zu finden und ein klares Zeichen zu setzen, dass man gegen faschistische Denkmäler sei. Diese würden übrigens noch heute als Symbol für Siegesfeiern u.a. genutzt.
Sandro Repetto (PD - Demokratische Partei) erinnerte u.a. an die demokratische Befragung zur Umbenennung des Platzes. Er unterstütze die Entschärfung faschistischer Monumente, diese seien in Orte des Wissens und des Bewusstseins umzuwandeln. Es irritiere ihn, wenn die Volkspartei keine Ideologie habe und keine historische Verbindung mit der Vergangenheit. Es sei notwendig, eine geteilte Lösung zu finden. Die PD wolle einen Friedensplatz.
LR Marco Galateo sagte u.a., dass er zur Zeit des Referendums Friedens- oder Siegesplatz gerade in die Politik gegangen sei. Es sei eine interessante Zeit gewesen. Heute habe man ein Siegesdenkmal, das von den Italienern nicht mehr als symbolischer Platz wahrgenommen werde - es fänden keine offiziellen Veranstaltungen dort statt. Es sei ein Platz, der an die Geschichte erinnere. Das Museum unter dem Denkmal gebe Einblicke in die Geschichte des Landes, wenn es auch noch besser beworben werden könnte. Man sollte keine Angst vor dem Siegesdenkmal haben, niemand identifiziere sich mit der Diktatur. Er könne nicht für den Begehrensantrag stimmen, dessen Ziel es einzig sei, negative Gefühle in der Bevölkerung hervorzurufen.
Es bedürfe einer weiteren Historisierung des Denkmals, so Renate Holzeisen (Vita) u.a. - auch wenn sie als Boznerin sich an dem Denkmal nicht stoße. Es gebe andere Dinge, die sie mehr störten. Die Historisierung des Denkmals müsse aber sichtbar sein - dies sei auch ein konkret erreichbares Ziel. Anschließend kritisierte die Abgeordnete “die demokratisch linke Seite”.
Jürgen Wirth Anderlan (JWA Wirth Anderlan) berichtete u.a. von einem Gespräch mit einem Historiker, der ihm gesagt habe, es handle sich um ein Mahnmal gegen den Faschismus. Für ihn allerdings handle es sich um ein Schandmal, denn die Mahnmale stünden entlang der Frontlinien. Das faschistische Symbol sei für ihn eine Beleidigung. Auch von der italienischen Bevölkerung wüssten nur 10 Prozent, was “das” überhaupt sei und welche Inschriften es trage. Er würde es nach Rom remigrieren.
Harald Stauder (SVP) verwies u.a. auf den breiten gesellschaftlichen Konsens, der notwendig sei, um solche Denkmäler zu entfernen - deshalb habe man den Weg der Historisierung eingeschlagen. In einigen Bereichen sei es gelungen, in anderen weniger. Auf dem Platz sei noch Platz etwas zu tun, es sei noch Raum, der Bevölkerung etwas mitzugeben. Man müsse weiter informieren und historisieren und das Denkmal als Mahnmal hinzustellen. Dabei gelte es auch klar darauf hinzuweisen, dass Unwahrheiten dargestellt worden seien. An den Abg. Zimmerhofer gerichtet, sagte Stauder, dass man nicht so tun dürfe, als ob überall in Europa faschistische, nationalsozialistische und kolonialistische Denkmäler abgebaut worden seien - es gebe in fast jeder russischen Stadt nach wie vor ein Lenin-Denkmal als Mahnmal.
Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) unterstrich u.a., dass der den Punkt teile, dass das Siegesdenkmal viel zu wenig historisiert worden sei. Er halte aber auch von einer kompletten Schleifung nichts. Wenn es richtig historisiert werden würde, dann könnte es vieles aus der Zeit des Faschismus aufzeigen. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass sich in Europa derzeit vieles ändere - man brauche nur an die postfaschistische Regierungsbeteiligung in Südtirol zu denken. Zudem sollte man “unsere” Geschichten, neutral beleuchten - es habe in den 1960er-Jahren einen Landtagsabgeordneten gegeben, der aktiv an der Deportation von Juden beteiligt gewesen sei. Das schlimmste faschistische Relikt sei nicht das Siegesdenkmal, sondern viel eher die Ortsnamen - diese verwende man jeden Tag. Hier gelte es eine Lösung zu finden.
LH Arno Kompatscher sagte in seiner Replik u.a., es sei gut, dass man über das Thema rede - es sei nie abgeschlossen und müsse immer wieder bewusst gemacht werden. Eine Historisierung mache Sinn, die Idee vom Propagandadenkmal zum Mahnmal sei treffend. Die Historisierung des Gerichtsplatzes sei noch nicht abgeschlossen. Beim Siegesdenkmal könne man darüber diskutieren, ob noch mehr gehe. Er lade alle ins Dokumentationszentrum unter dem Denkmal ein, er halte diese Ausstellung für sehr gelungen. Er stimme der Aussage zu, dass es eine ungenügende Aufarbeitung dieser Zeit in Italien gebe - es sei mehr notwendig. Ebenso wie hinsichtlich des Umgangs der Rechtsprechung mit dem sogenannten römischen Gruß. Man stimme dem Antrag nicht zu, weil es nicht funktionieren werde, damit ein Bewusstsein zu schaffen. Viel eher brauche es einen gesellschaftlichen Diskurs im Hinblick auf den Namen Siegesplatz. Er fände es auch eine Frechheit, dass es in Bozen eine Amba-Alagi-Straße gebe. Es gelte, pragmatische und vernünftige Lösungen zu finden; es brauche das Bewusstsein für die Geschichte - aber das Rad der Geschichte zurückzudrehen, funktioniere nicht. Man wolle zum Thema keine Mehrheitsabstimmungen im Landtag machen, sondern man wolle an einem breiten Konsens in der Bevölkerung arbeiten. So sei man bereits weitergekommen; es sei etwa vor 30 Jahren nicht möglich gewesen, ein Dokumentationszentrum einzurichten oder Anschriften anzubringen.
Brigitte Foppa (Grüne) schlug u.a. vor, den Punkt 5 folgendermaßen umzuformulieren “Gedenkveranstaltungen und Paraden vor Denkmälern und Symbolen des Faschismus zu unterlassen”.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) nahm den Vorschlag an und ergänzte u.a., dass der LH einen Denkfehler hinsichtlich der Mehrheitsentscheidungen im Landtag unterliege: Es bringe jene weiter, die die Denkmäler und Ideologie seit über 80 Jahren beibehalten wollten. Es brauche auch nicht den Konsens der gesamten Bevölkerung - den werde es nicht geben. Es brauche viel eher mutige politische Entscheidungen. Sei es normal, vor einem Denkmal mit Liktorenbündeln, irgendwelche Paraden abzuhalten? Diese Frage stelle er insbesondere an die Italiener. Daran sehe man, dass die Historisierung nicht funktioniere. Der Antrag sehe auch nicht vor, alles wegzusprengen, Teile davon sollten in einem Museum ausgestellt werden. Es beleidige ihn, dass er sich als Südtiroler als Barbar bezeichnen lassen müsse, wenn er das Denkmal ansehe.
Der Begehrensantrag Nr. 42/25 wurde getrennt nach Prämissen und einzelnen Punkten des beschließenden Teils abgestimmt und mehrheitlich abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 325/25 Südtirol Pass als Anerkennung für die Arbeit der Freiwilligen in den Rettungsdiensten (eingebracht von den Abg. Köllensperger, Ploner A., Rieder und Ploner F. am 15.10.2025): Der Landtag möge die Landesregierung auffordern, den Freiwilligen in den verschiedenen Rettungsdiensten den Südtirol Pass Fix 365 kostenlos zur Verfügung zu stellen.
In Südtirol leisteten die Freiwilligen in den Rettungsdiensten einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft, unterstreicht Paul Köllensperger (Team K), Erstunterzeichner des Antrages, in den Prämissen u.a. Ob beim Weißen Kreuz, beim Roten Kreuz, bei den Freiwilligen Feuerwehren oder bei der Bergrettung – tausende engagierte Menschen stellten ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Energie unentgeltlich zur Verfügung; sie seien Tag und Nacht einsatzbereit, um bei medizinischen Notfällen, Unfällen oder Naturereignissen schnell Hilfe zu leisten. Bemerkenswert sei der Gemeinschaftssinn: Viele junge Menschen engagierten sich früh, ältere blieben mit Erfahrung aktiv. Dieses freiwillige Engagement sei ein Grundpfeiler des Südtiroler Zusammenlebens und Ausdruck einer Kultur der Solidarität, die ohne den Einsatz der Freiwilligen nicht denkbar wäre. All diesen Personen, die freiwillig in den vielen Rettungsdiensten arbeiten, gebühre eine Anerkennung ihrer Tätigkeit, die über lobende Worte hinausgehen sollte. Eine solche Anerkennung könnte ein kostenloser Südtirol Pass Fix 365 sein, wie er den öffentlichen Bediensteten gewährt werde – den die Gewerkschaften übrigens nicht gefordert hätten, sondern den das Land „dazugegeben“ habe.
Brigitte Foppa (Grüne) bezeichnete den Vorschlag als sehr schön - die Grünen würden ihn mittragen. Es habe in der Vergangenheit den Kulturpass für ehrenamtlich Tätige gegeben, das sei eine wunderbare Sache gewesen. Sie wolle LR Alfreider sagen: Sie habe den Südtirol Pass Fix 365 gleich beantragt, doch bis heute gehe er nicht.
Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) unterstrich u.a., man könnte den ÖPNV in Südtirol generell auf andere finanzielle Beine stellen und die Südtiroler kostengünstiger fahren lassen. Er sei überzeugt, dass auch ein Gratis-ÖPNV finanzierbar sei. Wie viele Linien würden angefahren, die keine klassischen Pendlerlinien seien? Diese würden angefahren, um die Gäste zu beliebten Zielen zu bringen. Egal, ob Ehrenamtliche oder Gemeindebedienstete - die wenigsten der öffentlich Bediensteten, die um den Pass angesucht hätten, würden mit dem Bus zur Arbeit fahren, trotzdem würden sie es schätzen, den Pass zu erhalten.
Maria Elisabeth Rieder (Team K), Mitunterzeichnerin des Antrages, sagte u.a., fast alle Südtirolerinnen und Südtiroler seien ehrenamtlich tätig, daraus könnte man rückschließen, dass alle den Pass erhalten sollten. In diesem Antrag habe man sich auf die Rettungsdienste beschränkt - es wäre ein kleines Zeichen, wenn diese den Pass erhalten würden. Es gebe die Möglichkeit, dass auch Betriebe den Gratis-Pass anbieten würden, aber sie wolle appellieren, dass der Pass sehr, sehr kostengünstig oder gratis für alle angeboten werde. Derzeit gebe es nämlich eine Ungleichbehandlung zwischen den öffentlich und privat Bediensteten.
Madeleine Rohrer (Grüne) erinnerte u.a. an das von den Grünen vorgeschlagene Klimaticket zum Preis von 100 Euro. Wenn man die Straßen und die Menschen, die entlang diesen leben, entlasten wolle, dann seien solche Schritte notwendig. Deshalb begrüße man auch den Antrag.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) bemerkte u.a., dass man beim Dreier-Landtag über die grenzüberschreitenden Rettungseinsätze gesprochen habe, und demnächst werde ein grenzüberschreitendes Ticket eingeführt. Könnte man den Antrag auf dieses Ticket ausweiten?
Zeno Oberkofler (Grüne) sagte u.a., er sei von Personen kontaktiert worden, die den Gratis-Pass beantragen wollten, die Schwierigkeiten mit dem Beantragen desselben hätten. Könne LR Alfreider dazu Auskunft geben?
LH Arno Kompatscher unterstrich u.a., er sei allen Freiwilligen im Bereich des Zivilschutzes dankbar für das, was sie leisteten - doch wenn man den ganzen sozialen Bereich ausspare, dann würden sich die Freiwilligen in diesem Bereich wohl weniger wertgeschätzt fühlen. Man würde in Teufels Küche kommen. Er halte den Antrag deshalb in dieser Form nicht sinnvoll. Ein Jahresticket um 250 Euro sei sehr günstig. Jene, die den ÖPNV kostenlos gemacht hätten, würden inzwischen vielfach wieder zurückrudern. Man habe mit der gefundenen Lösung in Südtirol eine sehr kostengünstige, bei der aber die Zugangskontrolle - die aus mehreren Aspekten notwendig sei - gewährleistet sei. Er habe zum Antrag Verantwortliche im Bereich Zivilschutz gehört, die ihm von der Annahme abgeraten hätten - nicht, weil man die Freiwilligen der Blaulichtorganisationen nicht schätze, sondern weil es der falsche Weg sei.
LR Daniel Alfreider ergänzte u.a., es sei gelungen, dass öffentlich Bedienstete ab 1. November um den Gratispass ansuchen könnten - 15.000 Angestellte hätten das bis gestern Abend getan. Als Landesregierung wollte man dieses Angebot aufnehmen, denn es sei Mobilitätspolitik. In Südtirol sei man mit dem 250-Euro-Jahresticket für den ÖPNV sehr günstig. In Österreich müsse man erst sehen, wie es mit dem Klimaticket weitergehe. Man werde kontrollieren, weshalb die Flex 365-Pässe der Grünen Abgeordneten nicht funktionierten.
Präsident Arnold Schuler verwies u.a. darauf, dass von Mitarbeitern des Landtages bereits Rückmeldungen gekommen seien, dass die Gratispässe funktionierten.
Das Fass habe der LH aufgemacht, indem es den Gratispass für die öffentlich Bediensteten gebe, so Paul Köllensperger (Team K) u.a. Dies werde von in der Privatwirtschaft angestellten als ungerecht empfunden. Er habe sich beim Antrag letztlich für die Freiwilligen in den Rettungsdiensten entschieden - obwohl er auch an verschiedene andere Gruppen angedacht hatte.
Der Beschlussantrag Nr. 325/25 wurde mit 16 Ja- und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 332/25 Faire Bezahlung bei der Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung (eingebracht von den Abg. Oberkofler, Foppa und Rohrer am 17.10.2025, Ersetzungsantrag vom 28.10.2025): Der Landtag möge die Landesregierung beauftragen,
1. das Entgelt für individuelle Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung an die Vergütung von Praktika in der öffentlichen Verwaltung anzupassen;
2. das Entgelt nicht mehr pro geleistete Arbeitsstunde, sondern pauschal pro Monat auszuzahlen;
3. Praktika zur Arbeitseingliederung mit gleichzeitiger Teilzeitbeschäftigung für einen befristeten Zeitraum zu ermöglichen;
4. die Anstellung von Menschen mit Behinderung im Rahmen von Arbeitseingliederungsprojekten auch über die fünfte Funktionsebene hinaus vorzusehen;
5. zu erheben, in welchen öffentlichen Körperschaften und Körperschaften mit öffentlicher Beteiligung die gesetzliche Quote für Betriebe ab 15 Mitarbeiter:innen, mindestens eine Person mit Behinderung einzustellen, nicht eingehalten wird und dementsprechend Maßnahmen zu ergreifen, um die Quote konsequent einzuhalten;
6. die gesetzliche Quote für Betriebe ab 15 Mitarbeiter:innen, mindestens eine Person mit Behinderung einzustellen, flächendeckend zu kontrollieren und die Nichteinhaltung, insbesondere die wiederholte Nichteinhaltung, zu sanktionieren.
Zeno Oberkofler (Grüne), Erstunterzeichner des Antrages, hebt in dessen Prämissen u.a. hervor, dass die Integration von Menschen mit Behinderung in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens für eine inklusive, gerechte und zukunftsfähige Gesellschaft unabdinglich sei. Arbeit spiele dabei eine besonders wichtige Rolle, denn sie ermögliche nicht nur wirtschaftliche Unabhängigkeit, sondern vermittle zugleich Wertschätzung, Selbstbestätigung und sozialen Austausch. Es liege daher im Interesse einer jeden Gesellschaft, Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen zu integrieren, insbesondere in die Arbeitswelt, um Chancengleichheit herzustellen, soziale Barrieren abzubauen und Vielfalt zu fördern. Arbeit sei weit mehr als ein Mittel zum Lebensunterhalt: Sie sei Ausdruck von Teilhabe, Würde und sozialer Anerkennung. Mit dem LG Nr. 7 aus dem Jahr 2015 habe das Land Südtirol die individuellen Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung eingeführt. Diese Maßnahme stelle praktikumsähnliche Projekte dar, die Menschen mit Behinderung gezielt auf eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt vorbereite. Hierbei kämen sozialpädagogische Instrumente wie Arbeitsplatzbegleitung, Bezugspersonen im Betrieb, Zielformulierungen, Lernaufgaben und gezielte Kompetenzentwicklungsmaßnahmen zum Einsatz. Ziel der Projekte sei es, den Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten und eine Reihe von Kompetenzen zu fördern. Die Projekte würden in enger Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Arbeitsmarktintegration und den Sozialdiensten durchgeführt. Studien des Amtes für Arbeitsmarktbeobachtung zeigten, dass 71 Prozent der Teilnehmer:innen nach zehn Jahren noch beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt seien, was die langfristige Wirksamkeit der Projekte belege. Die Dauer der Vereinbarungen betrage drei bis zwölf Monate und könne bis zu fünf Jahre verlängert werden. Individuelle Vereinbarungen seien kein Arbeitsverhältnis und daher nicht sozial- oder rentenversichert. Gerade deshalb dürften sie nicht zum Dauerzustand werden und keinesfalls einen fixen Arbeitsvertrag ersetzen. Ziel der Maßnahme sei die Integration, nicht die dauerhafte Substitution regulärer Beschäftigungsverhältnisse. Derzeit sei eine parallele Nebentätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt während eines Arbeitseingliederungsprojekts nicht möglich. Diese Regelung schränke jedoch die Möglichkeit ein, nach dem Praktikum eine fixe Anstellung zu bekommen. Es sollte daher ermöglicht werden, für einen befristeten Zeitraum die Wochenarbeitszeit innerhalb des Arbeitseingliederungsprojekts zu reduzieren, um gleichzeitig eine Teilzeitstelle in einem regulären Betrieb aufnehmen zu können. Langfristig würde eine solche Regelung nicht nur den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt erleichtern, sondern auch die Effektivität von Integrationsmaßnahmen insgesamt erhöhen. Sie wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer praxisorientierten, inklusiven Arbeitsmarktpolitik, die individuelle Potenziale gezielt stärkt und nachhaltige Beschäftigungsperspektiven schafft. Es werde zudem festgestellt, dass die individuelle Vereinbarung zur Arbeitseingliederung von Menschen mit Behinderung derzeit lediglich eine spätere Anstellung in der Landesverwaltung sowie in der Schulverwaltung bis zur V. Funktionsebene vorsehe, also in jenen Ebenen der öffentlichen Verwaltung, für die nur der Abschluss der Bildungspflicht erforderlich ist. In der Praxis führe diese Bestimmung häufig dazu, dass Menschen mit Behinderung, die über höhere Bildungsabschlüsse verfügen, über ein Arbeitseingliederungsprojekt keinen Zugang zu jenen Berufsbildern der öffentlichen Verwaltung erhalten, die ihrem Ausbildungsstand entsprechen. Daher wäre es wichtig, zu prüfen, inwieweit die Möglichkeit besteht, abweichende Kriterien von den Bestimmungen des Gesetzesdekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 zu formulieren, um eine Aufhebung der derzeitigen Beschränkung auf die V. Funktionsebene vorzusehen. Die Vergütung für Praktika zur Arbeitsmarktintegration betrage maximal 492 Euro pro Monat, abhängig von der vereinbarten Wochenarbeitszeit. Ein großes Problem dabei: Die Höhe der Vergütung sei seit 2016 nicht angepasst worden. Zusätzlich sei die aktuelle Berechnung des Entgelts problematisch, da es ausschließlich auf den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden basiere. Dass die Vergütung der Praktika zur Arbeitsintegration zu niedrig sei, zeige sich deutlich im Vergleich mit den Praktika, die von der öffentlichen Verwaltung angeboten werden. Während diese Programme klar definierte und faire Entlohnungsrichtlinien aufwiesen, blieben die finanziellen Rahmenbedingungen für Praktika zur Arbeitsintegration weit hinter diesen Standards zurück. Menschen mit Behinderung sollten auf dem Arbeitsmarkt keinesfalls benachteiligt werden. Daher sollte die Vergütung dieser Praktika dringend an jene der Sommerpraktika in der öffentlichen Verwaltung angepasst werden. Eine solche Maßnahme sei ein klares Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit, Inklusion und Chancengleichheit. Sie sei ein wichtiger Schritt hin zu einer Arbeitswelt, in der Leistung, Engagement und Potenzial unabhängig von einer Behinderung gleichwertig anerkannt und honoriert werden. Neben der Anpassung des Entgeltes bei individuellen Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung sei auch die Integration von Menschen mit Behinderung in reguläre Betriebe von zentraler Bedeutung. Nach dem Gesetz des 12 März 1999, n. 68 müssten Betriebe ab 15 Mitarbeiter:innen mindestens eine Person mit Behinderung einstellen. In der Praxis werde diese Verpflichtung jedoch häufig umgangen, da die verhängten Strafen zu gering seien, um einen wirksamen Anreiz zu schaffen. Viele Betriebe zahlten lieber geringe Strafen, anstatt eine Person mit Behinderung einzustellen. Dieses Verhalten schwäche den Grundgedanken des Gesetzes erheblich und verhindere eine flächendeckende Teilhabe am Arbeitsmarkt. Es sei daher dringend notwendig, die Umsetzung und Durchsetzung dieser gesetzlichen Verpflichtung zu stärken. Nur durch eine konsequente Anwendung des Gesetzes könne die Integration von Menschen mit Behinderung in die Arbeitswelt nachhaltig gefördert und ihre gesellschaftliche Teilhabe gesichert werden.
Alex Ploner (Team K) erklärte u.a., dass es hier um die Würde und die Teilhabe am Leben von Menschen mit Behinderungen gehe - und da gehöre die Arbeit dazu. Er kenne die Voraussetzungen, die Erwartungen und Wünsche von Betroffenen und ihrer Eltern. Der Abgeordnete verlas einen Brief, in dem eine Mutter einen konkreten Fall schildert. Man sei beim Thema Inklusion noch nicht wirklich weit gekommen, dies sei auch einem Kulturproblem der Arbeitgeber im Land geschuldet. Es bemühten sich zwar sehr viele Menschen, doch es gebe verschiedenste Problematiken - auch in den Werkstätten oder dass die Praktika fünf Jahre dauern könnten. Er stimme dem Vorschlag des Kollegen Oberkofler voll zu.
Madeleine Rohrer (Grüne), Mitunterzeichnerin des Antrags, schickte voraus, dass man in der Gesellschaft über den Beruf definiert werde, und ergänzte u.a., Praktika seien wesentlich für die Berufswahl, für das Lernen und den Einstieg. Es sei notwendig, dass die Praktika entsprechend vergütet würden - auch Menschen mit Behinderungen.
Hannes Rabensteiner (Süd-Tiroler Freiheit) sagte u.a., man dürfe die Schwierigkeiten der Menschen mit Behinderungen nicht vergessen - aber ebenso wenig das Potenzial, das in ihnen stecke. Das dürfte insbesondere die Wirtschaft nicht außer Acht lassen, in der Arbeitskräftemangel herrsche. Hier gebe es Menschen, die arbeiten wollten. Die Wirtschaft müsse sich Gedanken darüber machen, wie man die Menschen entsprechend integriere und welche Arbeiten sie machen könnten, um ihren Beitrag zu leisten. Er stimme dem Antrag zu.
Brigitte Foppa (Grüne), Mitunterzeichnerin des Antrages, bezog sich u.a. auf die Anhörung zum Thema Menschen mit Behinderungen im IV. GGA, in der es um viele Bereiche gegangen sei. Ein wichtiges Thema sei gewesen: der Moment, wenn der junge Mensch aus der Schule komme. Denn dann fingen die Probleme an. Die verschiedenen Initiativen zur Arbeitseingliederung seien sehr löblich. Doch der Wert, den Menschen mit Behinderungen in die Betriebe und Organisationen brächten, werde vielfach noch unterschätzt. Es gebe verschiedene Weltbilder, Erlebnisse, Bedürfnisse - als dies brächte eine Bereicherung. Es gehe gar nicht, dass Menschen mit Behinderungen lächerliche Summen ausbezahlt würden; der Wert der Arbeit, der beruflichen Leistung müsse so vergütet werden, wie es richtig sei.
Waltraud Deeg (SVP) sagte u.a., sie wolle das Protokoll der Anhörung allen Kollegen zur Verfügung stellen. Sie sei gestern bei der Veranstaltung NoLimits gewesen, bei der es um Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung gegangen sei. Jeder solle den gleichen Zugang und dieselben Chancen haben - diesbezüglich gelte es noch vieles zu tun. Die Barrierefreiheit sei eines der großen Themen, das nicht nur Menschen mit Behinderungen betreffe. Personen, die sich engagierten, müssten angemessen entlohnt werden. Die Abgeordnete erinnerte an eine Unterrichtserfahrung, die sie “geflasht” habe. Die Diskussionen um die Zuständigkeiten lösten keine Probleme der Menschen - es sei notwendig, dass pragmatische Lösungen im Sinne der Menschen gefunden werden.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) verwies u.a. darauf, dass es unterschiedlichste Formen von Beeinträchtigungen gebe - manche davon machten eine Begleitung notwendig, andere aber ermöglichten auch hochqualifiziertes Arbeiten. Man müsse auch den ökonomischen Wert sehen, den Menschen mit Behinderungen generieren könnten. Es gebe in Südtirol einen Betrieb, der gezielt Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen anstelle; dieser Betrieb wäre froh, wenn er durch die öffentliche Hand mehr Aufträge erhalten würde. Es sei notwendig, dass solche Betriebe auch die notwendige ökonomische Unterstützung bekommen.
Franz Ploner (Team K) erklärte u.a., dass auch er bei der Anhörung im IV. GGA dabei gewesen sei. Bei der Auswahl der Anzuhörenden habe man sich bemüht, eine breite Palette abzudecken. Einen Schwerpunkt habe man auch darauf gelegt, zu erfahren, wie die Menschen bezahlt werden und wie sie beschäftigt sind. In der Schule seien diese Menschen mit Behinderungen weitgehend geschützt, kaum tritten sie ins Arbeitsleben ein, fielen sie durch den Rost. Sie hätten meist Verträge in Form von Zuwendungen. Doch Integration heiße auch Sozial- und Pensionsversicherung. Viele seien von Altersarmut bedroht. Man werde dem Antrag zustimmen, weil es wichtig sei, Menschen mit Behinderungen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Jürgen Wirth Anderlan (JWA Wirth Anderlan) bemerkte u.a., er werde den Antrag unterstützen und berichtete von verschiedenen persönlichen Erfahrungen. Er wisse etwa von einem Unternehmer, der sich schwertue, Mitarbeiter mit Beeinträchtigung zu finden. Es sei wesentlich, dass Menschen mit Beeinträchtigung eine Aufgabe hätten und eingebunden seien.
LRin Magdalena Amhof führte in ihrer Replik u.a. aus, dass eine inklusive Gesellschaft einen inklusiven Arbeitsmarkt voraussetze. Heute gebe es ein Amt für Arbeitsinklusion von Menschen mit Behinderung, seit 2017 gibt es die Vereinbarungen. Seitdem arbeiten die Mitarbeitenden daran, dass die Vereinbarungen in einem nachhaltigen Arbeitsverhältnis endeten. Man habe in den vergangenen sieben Jahren sehr viele Menschen über diesen Weg in ein Arbeitsverhältnis gebracht. Arbeit habe mit Würde zu tun, aber ermögliche auch ein selbstbestimmtes Leben. Man arbeite daran, auch möglichst viele Menschen mit Behinderung in ein selbstbestimmtes Leben zu bringen. Ziel sei, dass die Menschen ein nachhaltiges und effektives Arbeitsverhältnis erhielten - man volle keine Praktikanten. Man sei einverstanden, Punkt 1 - den Antrag um eine Erhöhung des Entgelts - anzunehmen. Derzeit würden ca. 4 Mio. Euro für die Arbeitsintegrationsmassnahmen aufgewandt. Sie bitte aber darum, die Anpassung an die öffentliche Verwaltung herauszunehmen - zunächst müssten Berechnungen vorgenommen werden. Punkt 2 werde man nicht zustimmen, auch Punkt 3 könne nicht angenommen werden - es sei gesetzlich so vorgesehen, dass ein Praktikum zur Arbeitseingliederung nicht zeitgleich zu einer Teilzeitbeschäftigung absolviert werden könne. Punkt 4 könne ebenso wenig angenommen werde, weil die Beschränkung auf die V. Funktionsebene gesetzlich geregelt sei. Punkt 5: Die freien Stellen in den öffentlichen Körperschaften und Körperschaften mit öffentlicher Beteiligung würden alljährlich erhoben; in den Listen der gezielten Vermittlung seien aber zu wenig Personen, um die zu Pflichtquoten zu füllen. Das Amt für Arbeitsmarktintegration habe 2024 rund 232 Personen vermittelt - von mehr als 800 Personen in den Listen. Man stimme deshalb den Punkten 5 und 6 nicht zu.
Zeno Oberkofler (Grüne) sagte u.a., es sei ein wichtiges Zeichen, dass man das Thema im Landtag besprochen habe - auch für die Menschen, die bei der Anhörung im Gesetzgebungsausschuss dabei gewesen seien. Er schlage vor, dass man in Punkt 1 einfüge, dass man sich an “der Vergütung von Praktika in der öffentlichen Verwaltung” orientieren wolle. Er wolle den Antrag bis morgen aussetzen, um mit der LRin eine passende Formulierung zu finden.
(Fortsetzung folgt)
tres