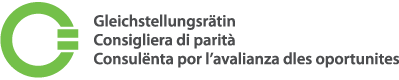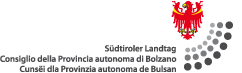News
Plenarsitzung – Frauen ohne Rente, Siegesdenkmal
Anträge von Team K und Süd-Tiroler Freiheit
Beschlussantrag Nr. 324/25 Frauen ohne Rente in Südtirol (eingebracht von den Abg. Rieder, Köllensperger, Ploner F. und Ploner A. am 13.10.2025, Änderungsantrag vom 23.10.2025): Der Landtag möge die Landesregierung verpflichten,
1. in Zusammenarbeit mit dem Landesinstitut für Statistik (ASTAT) eine Sonderauswertung zum Anteil der Frauen ab 67 Jahren ohne jegliche Rentenleistung (einschließlich Nicht-Bezieher:innen des Assegno sociale) vorzunehmen und diese Daten nach Familienstand, Migrationshintergrund und Pflegebiografien zu differenzieren;
2. die Ergebnisse dieser Erhebung und Analyse dem Landtag innerhalb des Jahres 2026 vorzulegen;
3. für Frauen in Südtirol, die keine eigene Rente erhalten und keine andere finanzielle Unterstützung bekommen, soll eine finanzielle Grundabsicherung eingeführt werden. Die Voraussetzungen dafür sollen klar geregelt werden.
Erstunterzeichnerin Maria Elisabeth Rieder (Team K) verweist in den Prämissen des Antrages u.a. darauf, dass sich trotz gesellschaftlicher Fortschritte und einer stetig steigenden Erwerbsbeteiligung von Frauen zeige, dass in Südtirol nach wie vor eine nicht zu vernachlässigende Zahl älterer Frauen lebe, die keinerlei Rentenleistung beziehe. Immer wieder berichteten Frauen, dass sie – trotz jahrzehntelanger Arbeits- und Lebensleistung – keine Rente erhielten, da sie die erforderlichen Mindestversicherungszeiten nicht erreichen konnten. Diese Frauen hätten oftmals jahrzehntelang unbezahlte Sorge- und Hausarbeit geleistet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt. Diese Tätigkeiten, obwohl von zentraler gesellschaftlicher Bedeutung, fänden im Rentensystem jedoch kaum oder gar keine Anerkennung. Während alleinstehende Frauen Anspruch auf das sogenannte Mindesteinkommen hätten, erhielten verheiratete Frauen in der Regel keine Unterstützung, da das Einkommen des Ehepartners angerechnet werde. Genaue Zahlen über das Ausmaß dieser betroffenen Frauen lägen derzeit nicht vor. Das Fehlen eines eigenen Rentenanspruchs führe in der Praxis häufig zu finanzieller Abhängigkeit vom Ehepartner oder gar von familiären Unterstützungsleistungen durch Kinder, Verwandte oder Freundeskreis. In vielen Fällen entstehe dadurch eine wirtschaftliche Abhängigkeit und Unselbstständigkeit im Alter, die die individuelle Entscheidungsfreiheit der betroffenen Frauen stark einschränke. Dies führe zu einer deutlichen geschlechtsspezifischen Ungleichbehandlung im Alter und stehe im Widerspruch zu den Zielen der Gleichstellungspolitik sowie zu den Grundsätzen sozialer Gerechtigkeit. Die fehlende finanzielle Eigenständigkeit im Alter wirke weit über den ökonomischen Bereich hinaus: Sie beeinträchtige das Selbstwertgefühl, die gesellschaftliche Teilhabe und erhöhe das Risiko sozialer Isolation. Frauen ohne eigene Rentenansprüche seien somit überdurchschnittlich häufig von Altersarmut, Abhängigkeit und sozialer Unsichtbarkeit betroffen. Hinzu kommt, dass diese Frauen in den offiziellen Statistiken nicht ausreichend erfasst würden. Etwas sichtbar werde diese Gruppe lediglich über den Assegno sociale – eine Sozialleistung für Bedürftige –, den im Jahr 2023 in Südtirol rund 1.000 Personen bezogen hätten. Auf Grundlage von Recherchen und direkter Nachfrage bei der INPS sowie beim ASTAT und der daraufhin erhaltenen Rückmeldungen zeige sich, dass weder die INPS noch das ASTAT derzeit über spezifische Auswertungen zur Zahl der Frauen ohne eigene Rentenleistung verfügen. Diese Datenlücke erschwere die Entwicklung gezielter sozialpolitischer Maßnahmen und trage dazu bei, dass das Problem sowohl politisch als auch gesellschaftlich weitgehend unsichtbar bleibe. Vor diesem Hintergrund bestehe dringender Handlungsbedarf.
Brigitte Foppa (Grüne) erinnerte u.a. daran, dass über die Rentenlücke und Altersarmut von Frauen im Landtag bereits öfter im Landtag gesprochen habe. Sie denke dann immer an das “Geschinde” von Frauen, die länger arbeiteten als Männer - das würden auch die Statistiken sagen. Dennoch sei die Rentensituation so, dass Arbeit am Ende zu Armut führe. Man könne für das Thema sensibilisieren. Man könne Renten aufstocken, so wie man es gemacht habe. Man könne nicht nur die “alten Frauen von heute” hinweisen, sondern auch die “alten Frauen von morgen” und deren Männer - wenn Frauen Teilzeit arbeiteten, dann sei die Altersarmut von morgen vorprogrammiert, auch wenn es heute für die Familie vieles einfacher mache.
Franz Ploner (Team K), Mitunterzeichner des Antrages, sagte u.a., dass der Beschlussantrag die Finger in eine große gesellschaftliche Wunde lege. Die Problematik betreffe viele Frauen, die ein Leben lang gearbeitet und Care-Arbeit geleistet hätten. Jede fünfte Frau über 65 sei armutsgefährdet, sage die Statistik. Manche müssten überlegen, ob sie die Heizung aufdrehen oder ob sie mit ihren Freundinnen einen Kaffee trinken könnten. Das führe zu sozialer Isolation. Frauen verdienten weniger, das spürten sie besonders im Alter. Besonders betroffen von Altersarmut seien alleinstehende Frauen. Man müsse die Altersarmut von Frauen verringern.
Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) verwies u.a. auf die Tausenden Frauen, die von Altersarmut gefährdet seien - ebenso wie andere Gruppen, die nicht außer Acht gelassen werden dürften. Es sei wichtig, dass man Daten dazu erhalte. Die grundsätzliche Frage sei: Schaffe man es im so reichen Südtirol nicht, den Seniorinnen und Senioren unter die Arme zu greifen, damit sie nicht von Armut betroffen sind? Man habe in der vorherigen Legislaturperiode einen Beschlussantrag genehmigt, in dem es um die Reaktivierung der sogenannten Nachbarschaftshilfe ging. Um gegen die Altersarmut vorzugehen, sei Geld zur Verfügung gestellt worden, allerdings müsse man jetzt den Weg finden, damit dieses Geld auch bei den Betroffenen ankomme.
Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit) bemerkte u.a., der Antrag sei sehr zu begrüßen. Man müsse zuerst erfassen, welche Personen betroffen seien, dann könne man sich mit der Finanzierung befassen. Das staatliche Rentensystem werde an die Wand gefahren, es sei ein eigenes Südtiroler System notwendig. Dann könnten solche Härtefälle im Land selbst gelöst werden.
Es sei legitim, solche Erhebungen, wie im Antrag gefordert, zu verlangen, so Sandro Repetto (PD - Demokratische Partei) u.a. und erinnerte an die sogenannte Hausfrauenrente. Der Beschlussantrag spreche auch den Unterschied zwischen verheirateten und unverheirateten Frauen an. Viele Haushalthilfen arbeiteten “schwarz”. Man habe in Südtirol eine gute Beschäftigungssituation. Er werde für den Vorschlag stimmen. Es sei angebracht, mehr in die Vorsorgeaufklärung zu investieren, aber auch zu prüfen, ob die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage von Frauen das Risiko mit sich bringe, dass ihnen nichts mehr zustehe. Er sei überzeugt vom Recht der Frauen auf eine angemessene Rente und habe sich dafür eingesetzt. Die Pflegearbeit müsse durch eine Zusatzvorsorge anerkannt werden.
Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit) unterstrich u.a., man könne im Landtag nicht oft genug über das Thema sprechen: Renten für Frauen, für Mütter. Auch sie habe bereits einen einstimmig angenommenen Antrag zum Thema eingebracht. Laut Daten der ASTAT gebe es in Südtirol 40.000 ältere Frauen, die weniger als 1.000 Euro erhielten - die Anzahl der Männer mit solch einer geringen Rente sei viel geringer. Rund 900 Arbeitnehmerinnen würden ihre Arbeit im ersten Lebensjahr ihres Kindes kündigen. Es sei notwendig, die Wahlfreiheit der Frauen zu unterstützen, damit diese nicht gezwungen seien zu kündigen, sondern die freie Wahl hätten, ob sie zu Hause bleiben oder wieder arbeiten gehen möchten.
Renate Holzeisen (Vita) sagte u.a., der Antrag beziehe sich auf Situationen, die sich aus der Vergangenheit ergäben - es sei wichtig, dass man dazu Daten erhebe. Deshalb unterstütze sie den Antrag. Etwas anderes sei die Diskussion über die aktuelle Situation von Frauen. Diesbezüglich wäre einiges machbar.
Waltraud Deeg (SVP) bezeichnete das Thema des Antrages als “nicht nur wichtig, sondern auch als berührend” und verwies u.a. auf die Geschichten, die hinter der Problematik stehen. Volkswirtschaftlich würde der Begriff Arbeit stets mit Einkommen gleichgesetzt, aber auch diese Frauen arbeiteten - ständig. Allerdings sei das beitragsbezogene Beitragssystem Italiens für Frauen mitunter ein “tödliches”. Südtirol habe im Bereich bereits einiges getan, etwa die Beiträge zur rentenmäßigen Absicherung. Doch das Thema der Vergangenheit habe man bis dato nicht gelöst, wenn es auch Unterstützungsmöglichkeiten gibt.
LRin Rosmarie Pamer erklärte in ihrer Replik u.a., dass das Erheben von Daten nie falsch sei. Das beitragsbezogene Rentensystem bringe Problematiken für Frauen mit sich - doch das sei vielen Frauen nicht bewusst. Es sei ihr Wunsch, dass das System geändert werde. Es gebe eine Unterstützungsleistung für ältere Menschen mit geringen Renten; im November werde diese ausgezahlt. Die Unterstützungsleistung erhielten aber nur jene, die eine Inps-Position hätten. Man werde die Zugangskriterien überprüfen. Punkt 3 könne sie nicht zustimmen, denn die Grundabsicherung gelte heute schon. Es gebe die finanzielle Sozialhilfe. Den ersten beiden Punkten könne sie zustimmen.
Antragseinbringerin Maria Elisabeth Rieder (Team K) sagte in ihrer abschließenden Stellungnahme u.a., das Thema sei in der Diskussion aus verschiedenen Seiten beleuchtet worden. Was das beitragsbezogene Rentensystem anbelange, sei es wichtig, in die Zukunft zu schauen. Ihr Antrag beziehe sich auf einen kleinen Ausschnitt in der Vergangenheit. Die betroffenen Frauen hätten keine Inps-Position, weil sie nie einer bezahlten Arbeit nachgegangen seien. Wenn die Landesrätin die Niedrigrenten aufwerten wolle, dann bringe es also für diese Frauen nichts. Man müsse deshalb versuchen, für diese Frauen, die in kein passendes Schema hineinpassen, andere Lösungen zu finden. Das sollte angesichts eines erneuten Rekordhaushalts möglich sein. Sie wolle in Punkt 3. den Begriff Grundabsicherung durch Unterstützung ersetzen.
Nach einer kurzen Diskussion von LH Arno Kompatscher und Maria Elisabeth Rieder (Team K) über den Fortgang der Arbeiten wurde der Beschlussantrag Nr. 324/25 getrennt nach Prämissen und einzelnen Punkten des beschließenden Teil abgestimmt: die Prämissen wurden mit 16 Ja, 16 Nein und 1 Enthaltung, Punkt 3 (mit der geänderten Formulierung) mit 16 Ja und 17 Nein abgelehnt, Punkt 1 und Punkt 2 wurden jeweils mit 33 Ja-Stimmen angenommen.
Begehrensantrag Nr. 42/25 Faschistische Denkmäler sind keine Mahnmale - das sogenannte Siegesdenkmal gehört ins Museum! (eingebracht von den Abg. Knoll, Atz, Rabensteiner und Zimmerhofer am 14.10.2025; Ersetzungsantrag vom 28.10.2025): Der Landtag möge beschließen:
1. Der Südtiroler Landtag verurteilt die Zurschaustellung faschistischer Symbole und Botschaften und hält fest, dass vom sogenannten Siegesdenkmal in Bozen bis heute eine ideologische Botschaft ausgeht, die die Verbrechen des Faschismus verherrlicht und die Südtiroler beleidigt.
2. Der Südtiroler Landtag distanziert sich von jeglichen Versuchen, die Symbolkraft des sogenannten Siegesdenkmals als entfaschistisiertes Kulturdenkmal zu verharmlosen oder als Mahnmal für den Frieden zu reinterpretieren, weil es dafür schlicht die äußeren Kriterien nicht erfüllt.
3. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung dazu auf, sämtliche Sanierungsvorhaben des sogenannten Siegesdenkmals einzustellen.
4. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung dazu auf, das sogenannte Siegesdenkmal abzutragen und Teile davon in einem Museum für Zeitgeschichte auszustellen, wo seine Geschichte wissenschaftlich und frei von ideologischen Vorgaben für die Allgemeinheit aufbereitet wird.
5. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Verteidigungsministerium und die Alpini auf, Gedenkveranstaltungen und Paraden vor Denkmälern und Symbolen des Faschismus zu unterlassen.
6. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, die im Innenhof des „Comando truppe alpine“ in Bozen befindliche Cäsarstatue, deren Sockel mit den faschistischen Liktorenbündeln flankiert ist, sowie alle übrigen im Besitz des italienischen Staates befindlichen Denkmäler des Faschismus in Südtirol zu entfernen und gegebenenfalls einige bzw. Teile davon einem Museum für Zeitgeschichte zur Verfügung zu stellen.
7. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Verherrlichung und Relativierung des Faschismus, etwa in Form des römischen Grußes, des Verkaufes von faschistischen Devotionalien (z.B. Mussoliniwein) sowie die Zurschaustellung von faschistischen Symbolen (z.B. „fiamma tricolore“), die Verbreitung von faschistischen Botschaften und die Verwendung von faschistischen Namen konsequent verboten und geahndet werden.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit), Erstunterzeichner des Antrages, unterstreicht in dessen Prämissen u.a., dass das sogenannte Siegesdenkmal in Bozen seit jeher für Kontroversen sorge. Dies habe einen einfachen Grund. „Das Denkmal, inklusive der kapitolinischen Wölfin und des Markuslöwen auf den flankierenden Pfeilern, steht sinnbildlich für den vermeintlichen territorialen Anspruch Italiens auf Südtirol und für die faschistische Ideologie“, so Knoll und führt die Bedeutung der Darstellungen am Monument aus. Seit seiner Einweihung am 12. Juli 1928 stehe das Denkmal, das an den Sieg Italiens im Ersten Weltkrieg erinnern solle, unverändert da. Von einer ideologischen Entschärfung könne – trotz wiederholter Beteuerungen von so manch politischer und auch wissenschaftlicher Seite – nicht die Rede sein, denn dafür erfülle es nicht das wichtigste Kriterium: Eine ideologische Entschärfung sei nur dann erreicht, wenn ein solches Denkmal unwiederbringlich in seine Einzelteile zerlegt werde – wie etwa beim Reichsparteitagsgelände der NSDAP in Nürnberg. Auch das im Jahr 2014 unter dem sogenannten Siegesdenkmal eingerichtete Dokumentationszentrum trage keineswegs zur Entschärfung des Denkmals bei; und selbst im Untergrund dürfe nicht die ganze Wahrheit gezeigt werden. Man könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass das sogenannte Siegesdenkmal dem Staat Italien bis heute als Machtinstrument diene, mit dem insbesondere der vermeintliche territoriale Anspruch auf Südtirol demonstriert werden solle. Andererseits wirke der Versuch, ein totalitäres Machtsymbol, das der Unterdrückung gewidmet sei, nachträglich in ein ideologiefreies Mahnmal für Demokratie und Frieden umzudeuten, geradezu zynisch. Mit einem faschistischen Denkmal Antifaschismus lehren zu wollen, sei ein Widerspruch in sich – so widersprüchlich, wie aus einem Schwert ein Friedenszeichen machen zu wollen. Das Ziel einer ideologischen „Entschärfung“ des Denkmals sei somit klar als gescheitert zu betrachten. Nun wolle die italienische Regierung das Denkmal einmal mehr mit Steuergeldern sanieren, was den Unmut in der Südtiroler Bevölkerung nur noch größer werden lasse; dies sei daher, im Sinne eines ehrlichen, respektvollen und friedlichen Miteinanders, entschieden abzulehnen. In den Prämissen wird zudem auf weitere Denkmäler und Symbole des Faschismus in Südtirol und dem restlichen Italien verwiesen, die zudem immer wieder Schauplatz von Gedenkveranstaltungen und Paraden seien – kürzlich hätten an einer solchen Gedenkveranstaltung in Bozen gar der stellvertretende Landeshauptmann von Südtirol, Marco Galateo, der Bozner Bürgermeister Claudio Corrarati, Senator Luigi Spagnolli sowie der Regierungskommissär für die Provinz Bozen, Vito Cusumano, teilgenommen, kritisierte Knoll.
Brigitte Foppa (Grüne) sagte u.a., dass im Antrag einiges zusammengemischt sei. Sie sei nicht derselben Meinung, was die steinernen Zeugen anbelange. Es habe sie immer gestört, dass die Finanzämter der Stadt Bozen in Gebäuden mit Mussolini-Relief untergebracht seien. Wichtig sei, dass die steinernen Zeugen als solche kenntlich gemacht und auch musealisiert würden. Man solle zu diesen Museen hingehen, um sich über eine leidvolle Zeit zu informieren. Den letzten Punkt des Antrages könne man mittragen.
Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit), Mitunterzeichner des Antrags, unterstrich u.a., dass weltweit Denkmäler von Diktatoren entfernt würden, und brachte einige Beispiele vor. In Südtirol aber würden sie aufgewertet. Die Relikte gehörten in ein Museum, man habe immer die Franzensfeste als Gesamttiroler Museum für Zeitgeschichte vorgeschlagen - das wäre die beste Lösung.
Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit), Mitunterzeichnerin des Antrags, verlas noch einige Punkte des beschließenden Teils des Antrags und ergänzte u.a., dass die Abstimmung über die Umbenennung des Siegesplatzes gezeigt habe, wie weit die Geschichtsfälschung und -aufarbeitung im Land sei. Es sei ein Armutszeugnis, wenn man sich mit Geschichtsfälschungen größer machen müsse.
Paul Köllensperger (Team K) bemerkte u.a., dass das Siegesdenkmal heute ein Mahnmal sei - zumindest sei es so geplant gewesen. Seiner Meinung nach sei es jedoch zu wenig entschärft worden. Der Weg der Historisierung sei eingeschlagen. Einen Antrag zur weiteren Entschärfung und Historisierung hätte man mitgetragen, aber den vorliegenden zum Abbau könne man nicht unterstützen. Dies würde zu einer weiteren Spaltung beitragen. Punkt 1 werde man unterstützen.
Zeno Oberkofler (Grüne) sagte u.a., es gebe zwei Wege: den von der Süd-Tiroler Freiheit vorgeschlagenen und den, den die Stadt Bozen und das Land beschreiten. Initiativen und Veränderungen seien möglich, aber es sei daran erinnert, dass das historische Konzept von renommierten Historikern entwickelt worden sei. Ein Besuch des Denkmals hilft auch Lehrern, ihren Schülern die lokale Geschichte näherzubringen und sie zum Nachdenken über die Verbrechen anzuregen, die an der lokalen Bevölkerung begangen wurden: Er hatte diese Erfahrung mit seiner Klasse gemacht. Dann erinnerte er an Senator Bertoldi, der die Schüler bei diesen Besuchen begleitet und über die Verbrechen des Faschismus in Europa gesprochen habe. Die Historisierung sei sicherlich der richtige Weg, damit die fürchterliche Geschichte in Erinnerung bleibe. Man werde nicht für den Beschlussantrag stimmen.
Die Arbeiten im Plenum werden um 14.30 Uhr fortgesetzt.
tres