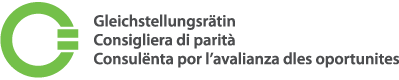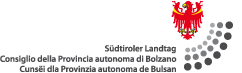News
Plenarsitzung – Direkte Demokratie (2)
Generaldebatte zu zwei parteienübergreifenden Landesgesetzentwürfen zur direkten Demokratie (Erstunterzeichner Grüne und Team K)
Am Donnerstagvormittag (9. Oktober 2025) wurde die Oktober-Sitzungsfolge 2025 des Südtiroler Landtages mit der am Mittwoch begonnenen gemeinsamen Behandlung der Landesgesetzentwürfe Nr. 6/23 Änderung des Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, „Direkte Demokratie, Partizipation und politische Bildung“ zur Zulässigkeit von Volksabstimmungen über die Regierungsformgesetze gemäß Art. 47 Autonomiestatut und eine Neuzusammensetzung der Kommission für die Abwicklung von Volksabstimmungen (vorgelegt von den Abg. Foppa, Ploner A., Oberkofler, Rohrer, Köllensperger, Rieder, Ploner F., Mair, Atz, Rabensteiner, Knoll, Wirth Anderlan, Zimmerhofer, Colli und Repetto) und Nr. 7/23 Änderung des Landesgesetzes vom 3. Dezember 2018, Nr. 22, „Direkte Demokratie, Partizipation und politische Bildung“ zur Erleichterung der Unterschriftensammlung und Einführung eines Sammelsystems für die elektronische Abgabe von Unterschriften (vorgelegt von den Abg. Ploner A., Foppa, Köllensperger, Oberkofler, Rieder, Mair, Ploner F., Rohrer, Leiter Reber, Atz, Rabensteiner, Knoll, Wirth Anderlan, Zimmerhofer, Repetto und Colli) wieder aufgenommen.
Nach einer kurzen Unterbrechung für eine Sitzung der Unterzeichner der beiden Gesetzentwürfe wurde die Generaldebatte fortgesetzt - nach den gestrigen Wortmeldungen von Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit) und LH Arno Kompatscher mit der Stellungnahme von LRin Ulli Mair. Sie unterstrich u.a., dass die direkte Demokratie ein wichtiges Korrektiv in einer Demokratie sei. Die Bürger wählten Politiker, von denen sie ausgingen, dass sie ihre Anliegen vertreten, man müsse den Bürgern auch zugestehen im Rahmen der direkten Demokratie selbst Entscheidungen zu treffen. Die Landespolitik habe in den vergangenen Jahren mit ihren Entscheidungen nicht immer die beste Figur abgegeben. Direkte Demokratie sei hier ein wesentliches Instrument, um Vertrauen wieder herzustellen. Auch sie sei nicht mit jedem Punkt in den vorliegenden Gesetzesvorlagen einverstanden - wenn Dinge drinnen stünden, die nicht mit dem Autonomiestatut vereinbar seien, dann seien diese zu überarbeiten. Sie stehe aber zu dem, was ihre Partei vor den Wahlen getan habe: nämlich mit ihrer Unterschrift diese Initiative im Landtag zu unterstützen. Es sei gelungen, im Bereich von Großprojekten verbindliche Volksabstimmungen im Regierungsprogramm aufzunehmen. Sie unterstütze beide Gesetzentwürfe und ziehe sich nicht zurück, auch auf die Gefahr hin, dass die Abstimmung eine Mehrheit haben werde - die Dinge, die zu ändern seien, werde man aber ändern müssen.
LR Marco Galateo sagte u.a., sein Name sei in vielen Medienartikeln aufgeschienen, weil er in der letzten Legislaturperiode den Pakt für die direkte Demokratie mitunterzeichnet habe - er sei damals überzeugt von dem Projekt gewesen. Mit der Entscheidung, diesen Gesetzentwurf mit einem Erstunterzeichner einzubringen, sei der Gesetzentwurf zu etwas geworden, dass die parteipolitischen Aushängeschilder unterstütze, er sei damit nicht mehr etwas, das alle betreffe. In der Mehrheit gebe es erstmals fünf politische Kräfte, die zusammenarbeiteten, nicht immer seien alle einer Meinung - dies bedeute aber nicht, dass die Mehrheit nicht zusammenarbeiten könne. Man habe Regeln festgelegt, damit man gemeinsam regieren könne - das werde von der Bevölkerung verlangt: eine stabile Regierung, die die Herausforderungen und Probleme angehe. Er sei überzeugt davon, dass einige Formulierungen, Zahlen und Vorgehensweisen, die die Meinungsbekundung der Bevölkerung angingen, überarbeitet werden müssten. Er könne nicht für den Gesetzentwurf stimmen, weil man ihn unter “politischen Fahnen” vorantreibe, anstatt im Landtag darüber zu diskutieren. Es gebe ein negatives Gutachten des Gesetzgebungsausschusses, eines des Rates der Gemeinden, der Vorschlag ist verfassungswidrig. Es gelte, gezielt das Interesse der Allgemeinheit im Auge zu behalten - sonst sei die direkte Demokratie lediglich ein Kostenfaktor. Man müsse in die Zukunft blicken, deshalb sei es wichtig, Regeln für die digitale Abstimmung festzulegen - darüber gebe es großes Einvernehmen. Er sei Mitglied des VKE, am 1. Oktober hätten die Mitglieder über ihre privaten E-Mail-Adressen eine Mitteilung erhalten, dass es eine Unterschriftensammlung für die Initiative für mehr Demokratie gebe - hier seien die Privatdaten der VKE-Mitglieder für einen Zweck verwendet worden, der nicht in im Tätigkeitsbereich des VKE liege. Das sei gravierend und dürfe nicht vorkommen. Er lade die Einbringer der LGE dazu ein, - nachdem das Thema sehr wichtig sei und “uns” alle betreffe -, die Gesetzentwürfe zurückzuziehen. Man könne dann gemeinsam und ernsthaft an den Vorlagen arbeiten, damit man mit diesem nach der Genehmigung auch arbeiten könne. Dies sei der einzig gangbare Weg. Es gehe hier um ein Grundrecht eines jeden Bürgers in einer Demokratie - und nicht um Parteifahnen.
Brigitte Foppa (Grüne) unterstrich u.a., der Kollege Galateo habe gedroht und auch gelogen: Der Abg. Galateo weiß sehr wohl, dass die Initiative für mehr Demokratie die Gesetzentwürfe in die Wege geleitet worden sei - alle Abgeordneten, die unterschrieben hätten, seien kontaktiert worden. Er habe nie gesagt, dass er der Erstunterzeichner sein wolle. Hätte er das sein wollen, hätte sie kein Problem damit gehabt, mitzuunterzeichnen. Man müsse demütig sein und hinter den Kulissen arbeiten - als Politiker und als Partei. Das täten die Grünen. Der LH habe gestern gesagt, die Gesetzentwürfe seien mangelhaft: Wenn etwas nicht passe, dann mache man im Landtag einen Änderungsantrag. Die Gesetzentwürfe seien seit eineinhalb Jahren auf dem Weg; sie könne nicht nachvollziehen, dass man nun - am Tag, wo die Vorschläge im Plenum behandelt werden - sage, man solle Arbeitsgruppen machen. Dieser Vorschlag sei an keinen der Mitunterzeichner vor der Behandlung im Plenum herangetragen worden. “Wir” seien für den parlamentarischen Weg, man wolle die LGE weiter behandeln.
Nach einer von Renate Holzeisen (Vita) beantragten kurzen Unterbrechung kritisierte LR Marco Galateo u.a., dass ihm Lügen unterstellt worden seien und warf dem Abg. Oberkofler einige Aussagen vor - man solle über Tatsachen sprechen.
Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia) sprach u.a. von Medienberichten über sie, in der ihr vorgeworfen worden sei, sie sei eine “Verräterin ihrer Wähler”. Sie aber sei nicht anwesend gewesen als die Unterschriften gesammelt worden seien. Sie betonte ihre ablehnende Haltung gegen die vorliegenden LGE. Sie sei Vorsitzende des I. GGA, auch dieser habe die Vorlagen abgelehnt. Sie gehe von einer klaren Ablehnung aus. Sie glaube sehr stark an die repräsentative Demokratie - und sei gegen eine Zerstückelung der Demokratie. Jeder Gewählte übernehme die Verantwortung für das, was er sage und tue. Heute würden die Volksabstimmungen in Bezug auf das Wissen seitens der Bevölkerung absolut ungenügend; nur wenige wüssten, worum es gehe. Eine Volksabstimmung sei beeinflusst von einer emotionalen Komponente, die von Politikern vorangetrieben werde, die die Möglichkeit hätten, die öffentliche Meinung zu steuern. Es werde auch die digitale Abgabe der Unterschriften gefordert, dann könne man nicht verlangen, dass die Unterschriftenhürden herabgesetzt würden.
Renate Holzeisen (Vita) erklärte u.a., dass sie viele Bedenken der Kollegin Scarafoni teilen könne - direkte Demokratie basiere auf Wissen. Nur derjenige, der Zugang zu Informationen habe, könne frei entscheiden. Sie werde noch heute einen Gesetzentwurf zur Informationspflicht einbringen. Direkte Demokratie sei im Grundsatz begrüßenswert, aber sie setze den freien Zugang zu ausgewogener Information voraus, die die Bevölkerung kapillar erreiche.
LR Philipp Achammer sagte u.a., das Dilemma an der Diskussion sei, dass alle mürbe seien - Opposition, Mehrheit und auch die Bevölkerung. Es habe in der vergangenen Legislatur einen Versuch einer Einigung gegeben. Das zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Demokratie nicht in ihrer besten Verfassung zeige. Man beschäftige sich hier mit der direkten Demokratie und dabei laufe “draußen, eine ganz andere Geschichte ab”. Er schlage vor, die Zweifel an den Gesetzentwürfen - insbesondere des aufhebenden Referendums - auszuräumen, bevor man sich im Plenum weiter damit beschäftige. Warum finde man nicht eine Basis, die größten Zweifel auszuräumen? Denn wenn das Verfassungsgericht dann sage, die Gesetze widersprechen der Verfassung, dann habe man alle noch einmal mehr mürbe gemacht. Wenn man etwas verabschiede, das nicht angewandt werden könne, was bringe es dann?
Waltraud Deeg (SVP) merkte u.a., dass man heute über ein wichtiges Instrument der Demokratie spreche: Es gehe um die Möglichkeit, wie Bürgerinnen und Bürger unmittelbar in politische Entscheidungsprozesse eingreifen können. Es betreffe das Fundament des demokratischen Grundverständnisses. Man müsse in Zeiten, in denen die Demokratie weltweit unter Beschuss stehe, umso mehr für demokratische Grundwerte einstehen. Sie sei eine Befürworterin der direkten Demokratie - und glaube daran, dass Demokratie lebendig bleibe, wenn sich Menschen an demokratischen Prozessen beteiligten. Das gefalle “uns” zwar nicht immer, aber Demokratie lebe davon, dass Entscheidungen getroffen würden. Es werde vielleicht langsamer und schwieriger, wenn man offene Debatten führe - dennoch finde sie das gut. Aber Demokratie müsse praktikabel sein und “uns” und die Menschen nicht überfordern - und es dürfe keine Dauerabstimmung sein. Und es dürfe auch nicht sein, dass man im Landtag keine Entscheidungen mehr treffen könne. Das Vertrauen in Demokratie stärke man, wenn man Entscheidungsprozesse stärke. Entscheidungen müssten auch nicht immer allen gefallen. Die Mehrheitsfindung sei im bestehenden Landesgesetz zu hinterfragen. Man habe sich damals geeinigt, dass das Quorum niedrig sein und dafür die Zahl der zu sammelnden Unterschriften höher sein solle. Man wolle ein funktionierendes Gesetz haben, aber zugleich sicherstellen, dass noch Entscheidungen getroffen werden könnten. Mit der digitalen Unterschriftensammlung habe sie kein Problem. Italien sei mit Spid und digitaler Unterschrift ein europäisches Best-Practice-Modell. Man habe in Italien damit Instrumente, die digitale Unterschriften einzuholen. Es tue ihr in der Seele weh, wenn es heute eine Kampfabstimmung geben sollte. Man sollte viel eher den einen oder anderen Punkt aufgreifen und verbessern, um in der Praxis umsetzbare Lösungen zu erarbeiten - auch als Zeichen für die Bevölkerung.
Franz Locher (SVP) hob u.a. hervor, dass Volksbefragungen und direkte Demokratie eine gute Idee seien. Er sei gemeinsam mit der Kollegin Foppa unterwegs gewesen, um möglichst viele Bürger zum Wählen zu animieren. Das digitale System könnte eine Bereicherung für die Bürgerbeteiligung sein. Meistens käme keine Änderung heraus, wenn eine Volksbefragung durchgeführt werde - man wisse nämlich, dass Volksbefragungen gemacht würden, damit ein Nein herauskomme. In vielen Gemeinden sei die Bevölkerung durch Projekte und Initiativen gespalten worden. Man könne eine Meinung durch eine Volksbefragung einholen, aber eine Entscheidung sei schwierig. Meist sei die Beteiligung auch gering. Der Abgeordnete erinnerte an die Volksbefragung zur Abschaffung der Atomenergie in Italien: In Italien würde nun keine Atomenergie mehr produziert, aber nahe der Grenzen stünden nach wie vor welche. Die Bevölkerung wünsche sich, dass etwas weiter gehe. Es sei wichtig, klare Signale zu geben und die Politik in die richtige Richtung zu bringen. Man mache demokratische Wahlen und versuche, geeignete Kandidaten zu finden, die sich um das Allgemeinwohl kümmern - das sei die beste Demokratie, die man haben könne. Müsse man auch “die Schneid haben”, das zu verteidigen. Er sei kein kompletter Gegner der Volksbefragung - allerdings müssten sich viele beteiligen.
LRin Magdalena Amhof erinnerte sich u.a. an die Ausarbeitung des Landesgesetzes zur direkten Demokratie, das 2018 verabschiedet wurde. Es sei ein breit angelegter Prozess gewesen, in dem Bürger, Interessenvertretungen und Sozialpartner eingebunden gewesen seien. Es sei ein Gesetz geworden, das nicht in Stein gemeißelt gewesen sei - Fehler und Tücken habe man gefunden und behoben. Direkt demokratische Instrumente könnten ein Teil der parlamentarischen Demokratie sein, dürften aber nicht die Oberhand gewinnen. Bestätigende Volksabstimmungen seien in bestimmten Bereichen nicht möglich, etwa wenn diese dem Autonomiestatut widersprechen. Man habe sich die Sache nicht einfach gemacht, wer die Anträge bewerten soll - man sei der Auffassung gewesen, dass es wichtig sei, dass es Richter seien. Deshalb denke sie, dass die Richterkommission bleiben solle. Sie sei einverstanden damit, dass man Instrumente wie die elektronische Unterschriftensammlung andenke und in Umsetzung bringe, allerdings gebe es derzeit noch keine zertifizierte Plattform dafür. Sie sei nicht dafür, die elektronische Unterschriftensammlung zu ermöglichen und gleichzeitig die Hürden für die Anzahl der Unterschriften herabzusetzen. Damit würde irgendwann die Arbeit im Landtag obsolet - auch jeder Abgeordnete habe eine bestimmte Anzahl von Unterschriften erhalten. Sie fände es nicht sinnvoll, wenn man unter das Mandat eines Abgeordneten gehe; man habe die Hürden damals an die Anzahl der Stimmen für ein Vollmandat angelehnt.
Arnold Schuler (SVP) sagte u.a., er wolle darauf hinweisen, dass er sich in seiner ersten Legislatur intensiv mit der direkten Demokratie befasst habe und auch einen Gesetzentwurf dazu eingebracht habe. Dessen mehrstufiger Ansatz sei innovativ gewesen. Quorum, Hürden und Art der Sammlung seien drei Faktoren, die wesentlich seien für die Anwendung des Instruments der direkten Demokratie. Sein Gesetzentwurf habe 2011 höhere Unterschriftenhürden vorgesehen, aber kein Quorum bei der Abstimmung. Das Gesetz sei gescheitert, weil es ein statutarisches gewesen sei und die vorgesehenen Hürden nicht geschafft habe. Nun sitze man wieder hier und diskutiere erneut über die direkte Demokratie. Wenn man hier etwas beschließe, dann sollte man auch bedenken, ob es regelkonform sei. Wenn die Landesregierung einen LGE vorlege, dann sei dieser vom Rechtsamt geprüft; diese Vorprozedur gebe es bei von Landtagsabgeordneten vorgelegten Gesetzesvorlagen nicht. Doch nicht nur das Rechtsamt des Landes, auch das Rechtsamt des Landtages bewerte die Art. 1 und 2 des LGE Nr. 6/23 als im Widerspruch zum Autonomiestatut. Auch das müsse man bedenken, wenn man die LGE behandle.
“Brauchen wir mehr Demokratie oder eine bessere Handhabung der Demokratie, die wir haben?”, schickte LR Christian Bianchi voraus und ergänzte u.a., Journalisten hätten ihm kürzlich die x-te Provokation der Süd-Tiroler Freiheit weitergeleitet: ein mit KI erstelltes Bild über die Entfernung des Grenzsteins, was zeige, dass es die Freiheit gebe, alles zu sagen, was man wolle, ohne Konsequenzen befürchten zu müssen. Die direkte Demokratie sei eine große Verantwortung für die Bürger - insbesondere in einer Region mit einem besonderen Gleichgewicht wie Südtirol. Eine direkte Demokratie gebe nur in sehr wenigen Ländern, die meisten hätten sich für die parlamentarische Demokratie entschieden - mit gewählten Vertretern, die bei ihren Entscheidungen das Allgemeinwohl im Blick hätten. Die Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind, nehmen an Volksabstimmungen nur teil, wenn es um ganz wichtige Fragen für die Zukunft gehe. Und wenn man für jede Kleinigkeit eine Volksabstimmung organisiere, dann stellten die Bürger die Frage, wozu die Politiker da seien, die sie ja gewählt haben, um Entscheidungen für sie zu treffen. Die direkte Demokratie sei ein sehr wichtiges Instrument - müsse aber mit Maß und Ziel gehandhabt werden und nur bei wesentlichen Fragen herangezogen werden. Die Fragestellungen bei Volksbefragungen müssten also so wichtig sein und alle betreffen, sodass die Politik die Entscheidung ans Volk weitergeben wolle.
(Fortsetzung folgt)
tres