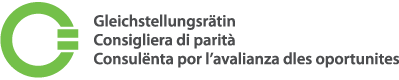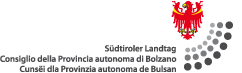News
Plenarsitzung – Rechnungslegung und Nachtragshaushalt – Generaldebatte (3)
Die Stellungnahmen von Knoll, Deeg und Wirth Anderlan in der Generaldebatte
Am heutigen Mittwochvormittag (30. Juli) hat der Südtiroler Landtag die gemeinsame Behandlung der drei von der Landesregierung auf Vorschlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher vorgelegten Landesgesetzentwürfe
- LGE Nr. 45/25 „Allgemeine Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2024“,
- LGE Nr. 48/25 „Nachtragshaushalt der autonomen Provinz Bozen für das Finanzjahr 2025 und für den Dreijahreszeitraum 2025-2027“ und
- LGE Nr. 49/25 „Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung der Autonomen Provinz Bozen für das Haushaltsjahr 2024“
fortgesetzt.
Zunächst ergriff in der Fortsetzung der Generaldebatte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) das Wort. Der Abgeordnete erklärte u.a., gestern sei viel über Europa gesprochen worden - Europa sei nicht nur Bürokratie. Er gehöre zu einer Generation, die mit allen Vorteilen Europas aufgewachsen sei, die sich aber auch noch an das davor erinnern könne. Es gebe positive Errungenschaften. Etwa dass der Schlagbaum am Brenner zurückgebaut worden sei; die EU biete Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit wie die EVTZ. Doch es gebe auch negative Dinge, beispielsweise Fehlentscheidungen vonseiten der EU, es würden auch Interessen vertreten. Es sei wichtig, auf Fehler hinzuweisen. Er wundere sich, dass man die Kultur der Kritik verloren habe. Doch Kritik biete die Möglichkeit, Fehler zu beheben. Europa sei im Ursprung eine Gemeinschaft gleichgesinnter Staaten, ein Gegenmodell zu anderen Weltmodellen. Doch die Regierungen entfremden sich zunehmend von der Bevölkerung - diese Entwicklung besorge ihn. Die sinkende Wahlbeteiligung in ganz Europa gebe Kunde davon. Die Bevölkerung werde oft nicht mehr gehört, wenn sie sich kritisch äußere. Die Äußerung von Kritik aber sei legitim. Dies würde er sich oft auch im Landtag wünschen. Die Politik treffe Entscheidungen, die für die Menschen nicht mehr nachvollziehbar seien - ein Beispiel dafür sei in Südtirol der Tourismus. Der Tourismus habe Positives im Land bewirkt, doch inzwischen hätten viele Menschen das Gefühl, es sei mittlerweile zu viel geworden, doch das werde nicht gehört. Das Drehkreuz auf der Seceda sei ein Aufschrei der Betroffenen; er sei in den 90ern häufig auf der Seceda gewandert - damals habe es keine Schlangen gegeben. Nun heiße es, in Meran würden 350 neue Betten ausgeschrieben. Man habe die Diskussion um das Zuviel und dann kämen solche Meldungen - das müsse bei der Bevölkerung auf Ablehnung stoßen. Eine Frage sei auch, wo man die Mitarbeiter für diese Betten finden wolle, auf dem heimischen Arbeitsmarkt gehe das nicht. Diese Menschen von außerhalb müssten auch Wohnungen finden, sie würden eventuell Sozialleistungen erhalten … Die öffentliche Verwaltung müsste sich die Frage stellen, wann genug genug ist. Man könne wirtschaftlich nicht unbegrenzt wachsen, doch die entsprechenden Fragen würden in der Politik oft nicht gestellt. Es freue ihn, dass im Landeshaushalt Mittel für die Gehälter der öffentlich Bediensteten bereitgestellt würden; auf der anderen Seite habe man die Situation, dass Beiträge des Landes seit Jahren nicht der Inflation angepasst würden. Den Familien bliebe immer weniger in der Tasche. Man habe den Eindruck, dass für gewisse Bereiche - wie etwa Hoch- und Tiefbau - im Landeshaushalt immer genug Geld zur Verfügung stehe, für Gehälter und Beiträge für die Bürger aber nicht. Dieses Gefühl müsse nicht der Wahrheit entsprechen, aber die Menschen hätten es. Im Gesundheitsbereich höre man, dass gewisse Menschen monatelang auf einen Termin warteten - einen solchen aber nicht bekommen; das führe dazu, dass sich die Menschen fragten, ob sie weniger wert seien, als die Menschen in Deutschland oder Österreich, wo diese Leistungen selbstverständlich seien. Man dürfe auch das Problem der Kriminalität im Zusammenhang mit der Zuwanderung nicht kleinreden; er habe sich Berichte aus etablierten Südtiroler Medien dazu herausgesucht, so der Abgeordnete, und zählte eine Reihe von Beispielen auf. Das sei die Wahrnehmung, die die Menschen im Land hätten. Was aber sei die Antwort der Politik? Man habe im Landtag Vorschläge eingebracht, etwa den Verlust von Sozialleistungen für Menschen, die kriminell sind - doch man sei kaum in der Lage gewesen, im Landtag seriös darüber zu diskutieren, sondern sei in Floskeln verfallen. Das dürfe nicht sein. Die Politik werde oft von Politikern geprägt, die glauben, sie hätten für sich die Weisheit gepachtet, die die Bürger domestizieren und belehren wollten. Nichts sei für ihn heiliger als das Wahlrecht, dieses sei der Kern der Demokratie, in Europa werde es aber ausgehebelt - Wahlergebnisse würden infrage gestellt, Parteien, die gewählt würden, würden ausgeschlossen. Weil der “dumme Wähler angeblich nicht versteht”, wen er wählen dürfe und wenn nicht. Dasselbe gelte für das Gendern: 75 Prozent der Bevölkerung in Deutschland seien derzeit gegen die derzeitigen Sprachregelungen - bei Wählern aller Parteien gebe es eine Mehrheit gegen die Genderregelungen. In Österreich würden 63 Prozent dagegen sein. Die Politik aber sage, es interessiere sie nicht - das mache man einfach, die Bevölkerung werde es schon nicht besser verstehen. So werde die Bevölkerung als “blöd hingestellt”. Wie könne man ein Projekt, das mehrheitlich abgelehnt werde, einfach umsetzen? Das bedeute nicht, dass man dem Diktat der Mehrheit hinterherrennen müsse. Man stelle fest, dass die Diskussion auch in “unserem” Land immer schwieriger werde. Er finde es schade, dass man es nicht schaffe, im Streit des LH und ihm eine Lösung zu finden. Der Abgeordnete kritisierte ein Medium und betonte, es sei ein Problem, wenn Medien beginnen, Politik zu machen. Es wäre notwendig, dass die Politik klar darauf hinweise, was die Rolle der Medien sei. Man solle bevor man vor Gericht gehe, persönlich reden. Die Politik - nicht nur in Südtirol, auch auf europäischer Ebene - gebe derzeit ein schlechtes Beispiel. Südtirol sei ein Land gewesen, das stolz darauf war, seine Kultur und Identität zu bewahren - obwohl es unfreiwillig zum italienischen Staat gehöre; nun werde die Kultur und Identität aufgegeben. Das bestätigten auch die Erfahrungen des Kollegen Rabensteiner im Einvernehmenskomitee; in vielen Bereichen der öffentlichen Hand könne man die deutsche Sprache nicht mehr verwenden. Die Landesregierung gebe der italienischen Post jährlich Millionen, doch die Dienstleistung, die “wir uns” erwarten, würde nicht erbracht - warum finde man nicht eine andere Lösung, beispielsweise einen eigenen Postdienst? Beim Thema Sicherheit habe man den Eindruck, dass man resigniere. Er hoffe, dass das Land Südtirol seinen Kompass wiederfinde - dieser sei in den vergangenen Jahren verloren gegangen. Südtirol habe sich früher an den Besten orientiert, nun würde aufgezeigt, dass man unter den Schlechten der Beste sei. Man müsse sich die Frage stellen, warum alljährlich Tausende junge Südtiroler auswandern. Die Antwort könne nicht sein, zuzuschauen, wie “unsere” Jungen über den Brenner auswandern und aus dem Süden Arbeitskräfte zu holen - das habe auch minderheitenpolitische Auswirkungen. Man habe 60.000 Menschen im Land, wo die Landesregierung keine Ahnung habe, wie sie integriert werden sollten. Es brauche einen auf die Südtiroler Bedürfnisse zugeschnittenen Integrationsplan; es gelte, sicherzustellen, dass die Ausländer, die nach Südtirol kommen, die deutsche Sprache lernen. Südtirol sei ein mehrheitlich deutschsprachiges Gebiet. Man müsse auch lernen, zu differenzieren, zwischen jenen, die sich integrieren wollen, und jenen, die kriminell werden und das Sozialsystem ausnutzen. Die Bürger müssten das Gefühl haben, dass etwas getan werde. Die Politik müsse mit den Behörden Kontakt aufnehmen und unterstreichen, dass Straftaten rigoros nachgegangen wird. Die LRin habe recht, wenn sie sage, es sei nicht “unsere” Zuständigkeit, zu entscheiden, wer eingesperrt wird und wer nicht - doch wer hindere “uns” daran, Druck auf Rom auszuüben oder zu entscheiden, wer “unsere” Sozialleistungen erhält und wer nicht. Menschen würden abwandern, weil sie sich andernorts bessere Lebensbedingungen erwarteten; das habe die Genfer Flüchtlingskonvention damals nicht mitbedacht - nun aber müsse darüber diskutiert werden. Es gelte auch darüber zu diskutieren, was Südtirol im Rahmen seiner Möglichkeiten besser machen könne, dabei gelte es drei Herausforderungen zu beachten - jene der Sicherheitspolitik, jene des Sozialen und der Gesundheit sowie jene der Bildung. Auch die Frage der Autonomie und des Minderheitenschutzes müsse bedacht werden; Rechte, die verloren gingen, bekomme man nicht mehr zurück - und wenn immer wieder ein Scheibchen abgeschnitten werde, dann sei das Ende der Wurst auch irgendwann erreicht. Die Frage, mit wem mache ich mich politisch gemein, stelle sich; die SVP habe zahlreiche rote Karten ausgeteilt - er, so der Abgeordnete, habe den Eindruck, die roten Karten seien inzwischen ausgegangen. Es gebe gefährliche Entwicklungen. Er wünsche sich von der Landesregierung in diesen Bereichen ein Einschreiten und eine Rückbesinnung auf vergangene Werte - und darauf, warum man eine Autonomie habe.
Wenn es um den Haushalt oder Nachtragshaushalt gehe, spreche man immer viel über Zahlen, so Waltraud Deeg (SVP) u.a. - es gehe aber auch um eine Prioritätendiskussion und darüber, wofür man die vorhandenen Mittel einsetze. Die Mittel würden von den Menschen im Land durch ihr persönliches Engagement erarbeitet; für diese Menschen arbeite man im Landtag. Die geopolitische Situation werde sich in den nächsten Zeiten nicht verbessern, die Menschen und die Systeme seien aber resilient - sie könnten mit Krisen umgehen; das sehe man auch daran, dass man heute über Mehreinnahmen spreche. Eine gut funktionierende öffentliche Verwaltung und gut funktionierende öffentliche Dienste schafften Vertrauen bei den Menschen; es müsse auch auf jene geschaut werden, die keine Lobby hätten, aber Unterstützung brauchten. Wenn man sich die Bereiche des Haushaltes ansehe, dann sei die Sanität mit fast 25 Prozent und 1,9 Mrd. Euro gut dotiert. Jeder Cent, der bei den Menschen, in den Gesundheitsstrukturen und den Mitarbeitern ankomme, sei gut investiert. Dasselbe gelte für die Pflege. Es gebe weitere Prioritäten, für die sich die SVP-Arbeitnehmer:innen immer eingesetzt hätten - im Gegensatz zu dem, was die Kollegin Rieder gestern gesagt habe. Dass es keine 2-Klassen-Medizin und -Pflege gebe, sei auch eine Errungenschaft der SVP-Arbeitnehmer. Die Umbenennung in die Soziale Mitte habe damit zu tun, dass gut funktionierende Dienste in zahlreichen Bereichen nicht nur die Arbeitnehmer beträfen, sondern den gesamten Mittelstand. Strukturelle, gute Löhne seien die beste Methode gegen den Brain Drain; wenn sie, so die Abgeordnete, mit jungen Menschen spreche, dann seien die Löhne immer Thema. Sie sei auch gegen Arbeitszeitreduzierung. Wenn junge Menschen aus dem Vinschgau in die Schweiz gingen, dann gehe es ihnen darum, gut bezahlt zu werden, dort habe man eine Wochenarbeitszeit von 42 Stunden. Lohnerhöhungen gebe es nicht durch Tagesordnungen, sondern durch faire Kollektivvertragsverhandlungen auf Augenhöhe - deshalb habe man nicht jede diesbezügliche Tagesordnung angenommen. Die Investitionsquote des Landeshaushalts liege bei 6 Prozent - das sei im europäischen Vergleich sehr gut. Wenn 25 Prozent des Landes-HH in die Sanität fließen, dann beinhalte dies auch Investitionen - nicht ausschließlich laufende Kosten. Es gelte, diesbezüglich genau hinzuschauen. Bei der Anerkennung von Berufstiteln oder erworbener Erfahrung gelte es Verbesserungen zu erzielen. Bei der Rolle der Lehrpersonen bei der Mensa sei sie der Meinung, dass dies Teil des Bildungsauftrags sein müsse - es gebe Best-Practice-Beispiele. Kein junger Mensch komme nach Südtirol und werde Lehrperson, weil er keine Mensaaufsicht machen müsse, es gehe um zahlreiche andere Aspekte. Sie sei auch gegen einen Rückbau öffentlicher Bildungszeiten. Die Anzahl der Kinder gehe statistisch zurück; wenn man wohnortnah Stellen an den Schulen aufrechterhalten wolle, dann könnte man diese durch Verlängerung der Betreuungszeiten und Mensadienste erreichen. Die Investition in die Lehrergehälter sei eine in die Zukunft und für den Wirtschaftsstandort Südtirol. Der Kollege Knoll habe die Form des Umgangs miteinander und die Rolle der Medien angesprochen: Eine korrekte Berichterstattung sei wichtig. Sie tue sich schwer mit den Methoden einer AfD.
Jürgen Wirth Anderlan (JWA - Wirth Anderlan) erklärte u.a., der Nachtragshaushalt sei ein guter - die Investitionen seien gut getätigt. Die 135 Mio. Euro für die Kollektivvertragsverhandlungen seien positiv, ebenso wie die 165 Mio. für die Landwirtschaft. 89 Mio. für den Hochbau gingen in Schulen, Kindergärten und anderes - er habe sich bei LR Bianchi erkundigt. Trotzdem laufe einiges schief, die ältere Generation leide an Altersarmut, Junge verließen das Land, es werde wie verrückt gebaut, andererseits gingen die Ressourcen aus, man habe keine Arbeitskräfte - und importiere solche. Diese würden im Gegenzug die “neuen olympischen Disziplinen” wie Stühle-um-die-Ohren-Hauen zeigen. Es gebe ein Gefühl der Ungleichbehandlung und Benachteiligung der einheimischen Bevölkerung. Der Abgeordnete verlas eine Auflistung von Zahlen und Daten zum Thema. Das Gefängnis, dessen Bau man irgendwann vielleicht erleben werde, baue man auch hauptsächlich für Ausländer, ebenso das Frauenhaus. Es gebe für diese Probleme nur eine Lösung: “Migrationsstopp und Remigration”. Man solle sich ein Beispiel an Dänemark nehmen. Die Wirtschaft, der Tourismus und der Export in Südtirol boome. Er wisse nicht, so der Abgeordnete, was die Folgen der “genialen” Verhandlungen der EU mit den USA im Zollstreit sein würden. Der Kollege Oberkofler habe gestern gesagt, er habe sich geschämt - wenn das so sei, dann hätten andere alles richtig gemacht. “Die Uschi” habe den Grünen gerade ihre Lebensgrundlage genommen, die Klimaziele könnten nun nicht erreicht werden. Der Abgeordnete kritisierte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, bezeichnete sie u.a. als “Wolf im Schafspelz”.
(Fortsetzung folgt)
tres