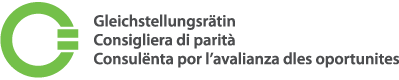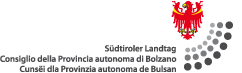News
Plenarsitzung - Artikeldebatte zum Sammelgesetzentwurf
Die Tagesordnungen zu Schutzhütten und Wasserzins. Die Artikel zur Nebentätigkeit der Beamten und zur Zusammensetzung der Bezirksräte.
Der Landtag hat am Donnerstag die Debatte zum Landesgesetzentwurf Nr. 44/25 wieder aufgenommen: Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Landesämter und Personal, Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, örtliche Körperschaften, Kultur, öffentliche Veranstaltungen, Unterricht, Sport und Freizeitgestaltung, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Wasserbauten, Gemeinnutzungsrechte, Jagd und Fischerei, Brandverhütung und Bevölkerungsschutz, Gewässernutzung, Landschaftsschutz und Umweltschutz, Energie, Naturparke und Naturschutz, Finanzen, Vermögen, Fremdenverkehr und Gastgewerbe, Alpinistik, öffentliche Bauaufträge, Lieferungen und Dienstleistungen, Wirtschaft, Arbeit, geförderter Wohnbau, Fürsorge und Wohlfahrt, Hygiene und Gesundheit (vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag von LH Arno Kompatscher).
Zunächst wurden noch Tagesordnungen zum Gesetzentwurf behandelt.
Die Süd-Tiroler Freiheit forderte die Übertragung der Schutzhütten an die Gemeinden: 1. Die Landesregierung wird beauftragt, die nötigen Schritte einzuleiten, um jene Schutzhütten, die im Besitz des Landes sind, den interessierten Gemeinden zu übertragen. 2. Die Landesregierung wird beauftragt, die Übertragung an die Gemeinden mit der Verpflichtung zu verknüpfen, dafür Sorge zu tragen, dass die Hütten instandgehalten und bewirtschaftet werden. 3. Die Landesregierung wird beauftragt, die Gemeinden zu verpflichten, ein kleines Museum zur wechselvollen Geschichte der jeweiligen Schutzhütte einzurichten. 4. Die Landesregierung wird beauftragt, die finanziellen Mittel, die hierfür benötigt werden, im Haushalt vorzusehen. 5. Der Landtag erkennt den kulturhistorischen Wert der historischen Hüttennamen in Südtirol an, welche eng mit der Geschichte Südtirols und dem aufstrebenden Alpinismus verbunden sind, und spricht sich für deren Erhalt und Weiterverwendung aus. Das Land sollte nicht Unternehmer spielen und möglichst delegieren, meinte Erstunterzeichner Bernhard Zimmerhofer. Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) unterstrich, dass die Übertragung als Möglichkeit, nicht als Pflicht gemeint sei. Er sprach sich auch gegen die Änderung der Hüttennamen aus, man würde damit ein Stück Geschichte verstecken. Man würde den Gemeinden mit einer Übertragung keinen Gefallen machen, antwortete LH Arno Kompatscher, das seien unterm Strich nicht Einnahmen, sondern Ausgaben. Das Land kümmere sich um die Hütten in seinem Besitz, in Zusammenarbeit mit den Alpenvereinen. Es verwies auch auf die neuen, klareren Förderungsschienen für die Schutzhütten des Landes, der Alpenvereine und der Privaten. Der Antrag wurde mit 9 Ja, 19 Nein und 1 Enthaltung abgelehnt.
Die Freie Fraktion forderte eine gezieltere Förderung der Schutzhütten: Die Landesregierung wird beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit ab dem Jahr 2026 Investitionen für primäre Infrastrukturen wie Trinkwasser-, Abwasser- und Stromversorgungsanlagen Südtirols Schutzhütten gefördert und einmalige Zuschüsse gewährt werden können. Strom-, Trink- oder Abwasserleitungen im schwierigen Gelände des Hochgebirges zu verlegen, verursacht das Vielfache an Kosten von Erschließungen im Tal, erklärte Einbringer Andreas Leiter Reber. Die Schutzhüttenbetreiber sind deshalb kaum im Stande, diese Kosten selbst zu tragen und den gesetzlichen Erfordernissen bei der Abwasserregelung zu entsprechen oder den heutigen Ansprüchen vieler Bergsteiger gerecht zu werden, was die Verfügbarkeit von Duschen oder Strom betrifft. Private könnten sich das nicht leisten, was das Land für seine Schutzhütten ausgebe. LR Luis Walcher erinnerte an die jüngst von ihm vorgelegten Förderungsrichtlinien. Er kündigte eine 25-prozentige Aufstockung für die Förderung der privaten Schutzhütten an, vor allem für Wasser und Abwasser oder Strom, aber nicht mehr für Erweiterungen und für Fahrzeuge. Der Antrag wurde mit 11 Ja, 17 Nein und 1 Enthaltung abgelehnt.
Die Freie Fraktion forderte auch die Berechnung der Wassergebühren in der Landwirtschaft nach dem Verursacher- und Vorsorgeprinzip: Die Landesregierung wird beauftragt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Wassergebühren in der Landwirtschaft künftig nach dem Verursacher- und Vorsorgeprinzip einzuheben und damit auch betriebliche Bewässerungsnetze und gewässerschonende Bewässerungspraktiken in den Obst- und Weinbaukulturen zu fördern oder von der derzeitigen Einhebungsform der Wassergebühren gänzlich abzusehen. Einbringer Andreas Leiter Reber wies darauf hin, dass praktisch nur die Obst- und Weinbauern im Tal die Wassergebühren zahlen, gleichzeitig seien genau diese aber von der Förderung für betriebliche Bewässerungsnetze und wassersparende Tropfberegnungen ausgeschlossen. LR Peter Brunner erinnerte daran, dass es für Obst- und Weinbau Nachlässe von 20 bis 35 Prozent bei den Wassergebühren gebe. Der Antrag wurde mit 11 Ja und 18 Nein abgelehnt.
Artikeldebatte
Im I. Titel des Gesetzentwurfs (Art. 1 bis 9) geht es um Landesämter und Personal, Gemeinden und Bezirksgemeinschaften, Örtliche Körperschaften, Kultur, öffentliche Veranstaltungen, Unterricht, Sport und Freizeitgestaltung. Im Folgenden die Artikel, zu denen eine Debatte stattfand.
Art. 1-bis betrifft die Nebentätigkeit des Personals im Landesdienst.
LR Magdalena Amhof hat dazu einen Ersetzungsantrag vorgelegt, mit dem man auf jüngste Urteile angehe, wobei man den Freiraum innerhalb der staatlichen Vorgaben höchstmöglich ausnutze. Brigitte Foppa bemerkte, dass mit dem Ausschluss freiberuflicher Tätigkeit sehr vieles ausgeschlossen sei. Maria Elisabeth Rieder meinte, dass die Regelung auf das Personal aller Schulen ausgedehnt werden sollte. Vor allem in der Berufsschule sollte der Herkunftsberuf auch weiterhin ausgeübt werden können. Was Aufträge für Landesbedienstete im Ruhestand betreffe, hoffe sie, dass man in Rom eine Ausnahme vom Verbot erreichen könne. LH Arno Kompatscher erklärte, dass das Dienstrecht staatliche Kompetenz sei, seit es ein Arbeitsverhältnis privatrechtlicher Natur sei, aber das werde sich mit der Reform des Autonomiestatuts wieder ändern. Mit der vorliegenden Bestimmung lehne man sich ein bisschen aus dem Fenster, aber er sei zuversichtlich, dass der Staat das nicht anfechten werde, weil er selber Lockerungen plane. Zum einen übernehme man die staatlichen Regelung, zum anderen sehe man Ausnahmen davon vor, bestätigte LR Amhof. Bei Aufträgen für pensionierte Beamte müsse man noch auf Rom warten.
Der Ersetzungsantrag wurde mit 29 Ja einstimmig genehmigt.
Art. 2 betrifft die Ordnung der Bezirksgemeinschaften.
Madeleine Rohrer legte dazu eine Reihe von Änderungsanträgen vor. Der Bezirksrat sollte von den Gemeinderäten bestellt werden. Die Vertretung von Mehrheit und Opposition im Bezirksrat sollte genauer definiert werden, dadurch, wer im Gemeinderat für oder gegen den Ausschuss stimmt. Die Opposition sollte allein entscheiden, wer sie im Bezirksrat vertritt. Jede Gemeinde sollte mindestens einen Vertreter der Mehrheit und einen der Minderheit entsenden. Im Bezirksrat sollen beide Geschlechter angemessen vertreten sein, gemäß ihrer Stärke in den Gemeinderäten, und falls nötig, durch eine zusätzliche Vertretung aus einem Gemeinderat mit hohem Frauenanteil. Brigitte Foppa erinnerte daran, dass man sich die Oppositionsvertretung im Bezirk vor Gericht erstreiten musste. Nun gehe es darum, dass auch die Opposition selber entscheidet, wer sie vertritt. Eine zwingende Frauenvertretung sei allseits begrüßt worden, aber im Gesetzentwurf fehle sie. Sie wunderte sich, dass es immer, wenn es um die Frauen gehe, auf die Komplexität der Regelung hingewiesen werde. Sven Knoll äußerte Zweifel zum Vorschlag, einen zusätzlichen Vertreter zu entsenden, falls das Verhältnis nicht erreicht werde, damit könne es passieren, dass das Sprachgruppenverhältnis nicht respektiert werde. Es müsse auch geklärt werden, ob es sich dabei um Gemeinderäte handle oder nicht. LH Arno Kompatscher betonte, dass man sich an das Gerichtsurteil halte. Was die Unterscheidung von Mehrheit und Opposition betreffe, wies er darauf hin, dass es auch in der Mehrheit unterschiedlicher Positionen gebe. Die Bezirksgemeinschaft übe ihre Funktion im Auftrag der Gemeinden aus, die ihrerseits von Mehrheiten regiert würden. Viele Gemeinden hätten in ihrer Satzung eine Definition von Mehrheit und Minderheit, und diese gelte, falls vorhanden, auch als Kriterium für die Entsendung in den Bezirksrat. Man wünsche sich eine angemessene Frauenvertretung, daher werde man dem entsprechenden Änderungsantrag zustimmen, auch wenn man noch Bedenken zur Anwendung habe. Die Gemeinden wollten durch ihren Chef im Bezirksrat vertreten sein, und das sei meist ein Mann.
Der Änderungsantrag der Grünen zur Geschlechtervertretung wurde mit 22 Ja und 6 Enthaltungen angenommen, die anderen wurden abgelehnt.
Es wäre wichtig, dass die Opposition selber entscheide, wer sie im Bezirksrat vertritt, meinte Maria Elisabeth Rieder. LH Kompatscher betonte, dass man mit dieser Regelung Klarheit schaffe.
Der Artikel wurde mit 20 Ja und 9 Enthaltungen genehmigt.
AM