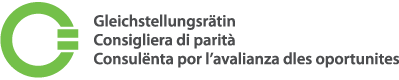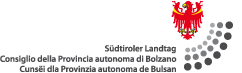News
Plenarsitzung - Aktuelle Fragestunde (2)
Fragen und Antworten zu geschützten Werkstätten, olympischen Spielen, islamischem Opferfest, Proporz, Kulturförderung, Bahnlinie Bozen-Meran, neues Landes-Logo, Bozner Buslinien, Kleinkindbetreuung
Die geschützten Werkstätten leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung, erklärte Thomas Widmann (Für Südtirol). Trotz des im November 2024 vom Südtiroler Landtag genehmigten Beschlussantrags Nr. 161/24: „Geschützte Werkstätten stärken und Fachpersonal sichern“ bestehen weiterhin lange Wartelisten und Unklarheiten zur tatsächlichen Versorgungslage. Der Bericht der zuständigen Landesrätin hierzu bleibt vage. Um fundierte Entscheidungen treffen zu können, braucht es eine klare Datenlage. Widmanns Fragen dazu: Wie viele Personen stehen aktuell (Stichtag 01.06.2025) auf Wartelisten für stationäre bzw. teilstationäre Dienste in den geschützten Werkstätten? Wie lange dauert die durchschnittliche und maximale Wartezeit, aufgeschlüsselt nach Altersgruppe? Wie viele neue Plätze wurden im Jahr 2024 geschaffen – getrennt nach stationär und teilstationär? Wie viele weitere Plätze getrennt nach stationär und teilstationär sind für 2025, 2026 und 2027 konkret geplant? Welche Kriterien werden angewendet, um die Dringlichkeit zur Vergabe eines Platzes festzustellen? In welchem zeitlichen Rahmen plant die Landesregierung, die Wartelisten signifikant zu reduzieren – und mit welchen Maßnahmen?
LR Rosmarie Pamer gab eine Übersicht über die Wartelisten in den geschützten Werkstätten. Diese würden auch vorübergehende Aufenthalte bieten, zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Tagen, je nach Bedürfnis. 2024 seien weitere Plätze geschaffen worden, zusätzliche seien auch für die nächsten Jahre geplant.
Laut Rai-Südtirol einigte sich die die Südtiroler Standortagentur IDM im Rahmen eines Sponsoringvertrages mit den Verantwortlichen der Winterspiele Mailand-Cortina über die Verwendung und Platzierung Südtiroler Produkte wie Äpfel, Wein, Speck und Milchprodukte, bemerkte Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion). Die Kosten von mehreren Millionen Euro sollen laut Rai-Südtirol größtenteils vom Land und zu einem kleinen Teil von beteiligten Konsortien stammen. Über die Summe könne allerdings nichts gesagt werden, diese sei – immer laut Rai Südtirol - geheim und auf Nachfrage bei IDM-Präsident Hansi Pichler wurde lediglich mitgeteilt, dass „im Sponsorvertrag ausdrücklich Stillschweigen vereinbart worden sei“. Südtirols öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat sich leider mit dieser Nicht-Antwort zur Verwendung von öffentlichen Steuergeldern zufriedengegeben, weshalb Leiter Reber folgende Fragen an die Landesregierung stellte: Wie viel zahlt das Land Südtirol direkt bzw. über Körperschaften wie die IDM, damit Produkte aus Südtirol bei der Olympia Mailand-Cortina an den Veranstaltungsorten verkauft und verabreicht werden? Wie viel zahlen andere öffentlich geförderte Konsortien? Mit welchen Absatzmengen lokaler Produkte rechnet das Land bzw. die involvierten Körperschaften im Rahmen der WM? Mit welchem Werbeeffekt rechnet das Land Südtirol und welche Auswirkungen für den Verkauf lokaler Produkte erhofft sich das Land durch diese Vereinbarung?
Bevor man die Zahlen öffentlich mache, wolle man das mit den Vertragspartnern absprechen, da noch Verhandlungen mit anderen im Laufen seien, erklärte LH Arno Kompatscher, der um Verständnis bat. Man werde die Zahlen auf jeden Fall veröffentlichen, sobald es möglich sei. Es gehe um mehrere Millionen und um Produkte wie Speck, Käse, Milch, Schüttelbrot. Die Marke Südtirol werde für die verschiedenen Werbekampagnen verwendet.
Eid al-Adha, das islamische Opferfest, ist einer der bedeutendsten Festtage im Islam mit der Tradition, ein Opfertier zu schlachten – in der Regel ein Schaf, eine Ziege oder ein Rind, erklärte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit). Das Schlachten der Tiere erfolgt traditionell durch das Schächten: Ein einziger Schnitt an Kehle, Speiseröhre und Halsschlagadern löst das Ausbluten aus, während der Name Gottes (Allah) ausgesprochen wird. Das Tier wird in der Regel ohne vorherige Betäubung geschlachtet, wie es die religiösen Vorschriften vorsehen. In Italien ist diese rituelle Schlachtung ohne vorherige Betäubung rechtlich nur unter der Einhaltung strenger Vorschriften erlaubt und ein Zuwiderhandeln sieht Freiheits- oder hohe Geldstrafen vor. Die „Comunità musulmana Salorno, Egna & Dintorni“ hat am 6. Juni 2025 um 08.00 Uhr zur „Festa Eid al-Adha“ auf dem Sportplatz von Salurn eingeladen. Knolls Fragen zur Veranstaltung: Wurde für die Nutzung des Sportplatzes/Veranstaltung ein Ansuchen gestellt und eine offizielle Genehmigung erteilt und ggf. eine Miete entrichtet? Sind der Gemeinde Neumarkt durch das Abhalten des Festes Kosten entstanden? Wurden im Rahmen des Festes Tiere geschlachtet bzw. geschächtet? Wenn ja, welche, wie viele, woher stammen diese Tiere und wo/wie wurden sie getötet? Wurden auf dem Sportplatz auch Speisen zubereitet (Grill, Feuer, Kochgelegenheiten…)? Wie viele Personen nahmen an der Feierlichkeit teil?
LH Arno Kompatscher verwies auf das Antwortschreiben der Gemeinde Salurn, an die man die Frage weitergeleitet habe. Demnach seien der Gemeinde sowohl die örtlichen Traditionen wichtig als auch die Integration der neuen Mitbürger. Dafür sprach Kompatscher der Gemeinde ein Lob aus. Die Gemeinde habe das genannte Opferfest autorisiert, ohne Kosten für die Gemeinde. Die genannte Schächtung habe, wie vereinbart, nicht stattgefunden. Die Speisen seien in den Wohnungen zubereitet und auf dem Fest verteilt worden.
Wieder ist eine grundsätzliche Diskussion über den ethnischen Proporz entfacht, erklärte Brigitte Foppa (Grüne). In der öffentlichen Wahrnehmung zeigt sich dabei einmal mehr eine grundlegende Unsicherheit darüber, ob der ursprüngliche Zweck dieser Regelung – nämlich die gleichmäßige und faire Verteilung öffentlicher Ressourcen zwischen den deutschen, italienischen und ladinischen Sprachgruppen in Südtirol – mittlerweile erfüllt ist oder ob weiterhin Ungleichgewichte bestehen. Es herrscht weitgehend Unklarheit darüber, wie regelmäßig entsprechende Daten erhoben, ausgewertet und verwendet werden. Ebenso bleibt oft undurchsichtig, wie sich die sprachgruppenbezogene Verteilung etwa im öffentlichen Dienst des Landes, im Staatsdienst, bei der Wohnungsvergabe oder in anderen Bereichen mit Proporzregelung konkret darstellt. Dazu richtete Foppa folgende Fragen an die Landesregierung: Wie ist der Umgang der Landesregierung mit den Daten zum Proporz? Wer erhebt wie oft welche Daten, um periodische Evaluationen vornehmen zu können? Wie gestaltet sich die Verteilung nach Sprachgruppen im öffentlichen Dienst (Land Südtirol)? Wie gestaltet sich die Verteilung nach Sprachgruppen im Staatsdienst? Wie gestaltet sich die Verteilung nach Sprachgruppen in der Vergabe von Wohnungen? Wie gestaltet sich die Verteilung nach Sprachgruppen in anderen Bereichen, die vom Proporz betroffen sind? Welchen Weg gedenkt die Landesregierung in dieser Sache zu gehen? Gibt es Aussicht auf eine Reform?
LH Arno Kompatscher betonte, dass die Landesregierung sich für Transparenz einsetze. Die erhobenen Daten würden in Datenbanken eingegeben und ständig auf dem Laufenden gehalten. Die Verteilung der Stellenpläne erfolge nach den Ergebnissen der Erhebung, separat nach Funktionsebenen. Die Zuweisung der Staatsstellen sei Zuständigkeit des Einvernehmenskomitees. Bei den Wohnungen gehe man gemischten Kriterien vor, weil auch der Bedarf berücksichtigt werde. Der Proporz bleibe eine Säule des MInderheitenschutzes, aber er müsse mit Bedacht angewandt werden, vor allem bei Personalmangel.
Mit Beschlussantrag Nr. 40/24 vom 13.02.2024, der am 28.11.2024 einstimmig angenommen wurde, wurde u.a. auch die Anpassung der Kriterien für mehrjährige Finanzierungen, dem Beispiel des Kulturgesetzes folgend, beschlossen. Der 31. Jänner 2025 war der Stichtag, um auch für diese mehrjährigen Finanzierungen anzusuchen, erklärte Alex Ploner (Team K) und ersuchte um die Beantwortung folgender Fragen: Welche Vereine, Komitees, ehrenamtliche Körperschaften/Organisationen haben für eine mehrjährige Finanzierung angesucht? Für die Realisierung welcher Projekte (laut Ansuchen) haben diese Organisationen angesucht? Für welchen Zeitraum, im Sinne der mehrjährigen Finanzierung, haben diese Organisationen angesucht? Was wurde und wird von der Landesregierung unternommen, um das Ehrenamt auf die Möglichkeit der mehrjährigen Finanzierungszusagen hinzuweisen?
LR Rosmarie Pamer bedauerte, die Antwort noch nicht vollständig liefern zu können, da einige Fragen sehr komplex seien. Die meisten anderen Daten seien bereits öffentlich zugänglich. Sie verwies auch auf den anstehenden Gesetzentwurf zum Ehrenamt. Ploner wandte ein, dass er bereits vor drei Monaten einmal um diese Daten gefragt habe.
Die Qualität der Betreuung in geschützten Werkstätten steht und fällt mit qualifiziertem Personal, bemerkte Thomas Widmann (Für Südtirol). Viele Träger schlagen Alarm: Unbesetzte Posten, mangelhafte Ausstattung, keine Gehaltsanpassungen seit Jahren. Die Stellungnahmen im Bericht der Landesregierung zu dem vom Südtiroler Landtag genehmigten Beschlussantrag Nr. 161/24: „Geschützte Werkstätten stärken und Fachpersonal sichern“ weichen konkreten Zahlen aus. Daher fragte Widmann nach: Wie viele Stellen in den Diensten zur Arbeitsbeschäftigung sind aktuell unbesetzt? Wie viele davon betreffen ausgebildetes Fachpersonal wie ArbeitserzieherInnen oder SozialpädagogInnen? Wie hoch ist derzeit das monatliche Bruttogehalt von ArbeitserzieherInnen in Vollzeit? Wann fanden die letzten Gehaltserhöhungen in welcher Höhe statt, wann stehen weitere in welcher Höhe an? Wie viele Kündigungen bzw. Pensionierungen gab es im Zeitraum 2010–2024 pro Jahr? Welche Maßnahmen zur Personalgewinnung - z.¿B. Ausbildungsinitiativen, Umschulungen, finanzielle Anreize - wurden konkret im 1. Halbjahr 2025 gesetzt? Welche sind geplant für 2026/2027/2028? In wie vielen Einrichtungen arbeiten derzeit Personen ohne fachspezifische Qualifikation? Gibt es ein Monitoring zur materiellen Ausstattung der Einrichtungen? Wenn ja: Was waren die Ergebnisse der letzten Erhebung?
LR Rosmarie Pamer antwortete, dass es in der kurzen Zeit seit der Einreichung der Anfrage nicht möglich gewesen sei, Daten über freie Stellen zu erheben; diese würden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. Was die Erzieherinnen und Erzieher betrifft, die in der 6. funktionalen Qualifikation arbeiten, so entsprechen die Gehälter der Qualifikation, zuzüglich einer Zulage von 17 %. Sie erinnerte daran, dass sie die entsprechende Tabelle bereits vorgelegt hat und dass im Tarifvertrag alles vorgesehen ist, auch die Erhöhungen. Am 16. Dezember wurde ein Vertrag geschlossen, der eine Pauschale als Vorschuss auf die bereits vereinbarte Lohnerhöhung vorsieht; eine weitere Pauschale wurde für 2025 festgelegt. Pamer verwies auch auf Beschluss zu Ausbildung und Karrieremöglichkeiten. Dank dieser Möglichkeit haben sich bereits 47 Personen für das Diplom und 21 für andere Kurse angemeldet. 113 Personen haben sich für die Teilnahme bereit erklärt. Die Überwachung der Einrichtungen und des Materials findet alle 6 Jahre statt.
Im April 2025 teilte LR Alfreider im Landtag im Rahmen der Beantwortung einer Anfrage zum Ausbau der Bahnlinie Meran-Bozen mit „innerhalb des Projektes unterschiedliche Alternativen aufstellen zu wollen, um die bestmögliche aussuchen zu können.“ Die bei den derzeit öffentlich präsentierten Ausbauvarianten angedachte „Aussiedelung“ des Bahnhofes Terlan vom Dorfzentrum weg in Richtung Etsch will jedoch nicht wirklich zu einem Bahnprojekt passen, das insgesamt den Anspruch hat, innovativ zu sein, die Menschen besser mit der Bahn verbinden will und möglichst wenig neue Flächen verbrauchen möchte, meinte Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion). Es drängt sich daher die Prüfung einer Variante auf, die sowohl eine begradigte Neutrassierung mit zwei Spuren oder zweispurigen Abschnitten vorsieht, um einerseits schnellere Direktverbindungen zwischen Meran und Bozen ermöglichen zu können und andererseits auch die Beibehaltung der bestehenden Trasse in Terlan berücksichtigt, für jene Züge, welche alle Stationen bzw. die Etschtaler Bahnhöfe anfahren. Leiter Rebers Fragen dazu: Hat die Landesregierung eine wie oben beschriebene „Bypass-Variante“ technisch ausarbeiten und überprüfen lassen? Wer hat wann die Überprüfung dieser Variante vorgenommen und welche Ergebnisse und Erkenntnisse konnten gewonnen werden? Falls noch nicht geschehen, beabsichtigt die Landesregierung eine „Bypass-Variante“ zu überprüfen? Wenn ja, wann und welche Techniker sollen damit beauftragt werden?
LR Daniel Alfreider stellte klar, dass auch eine Variante auf der Höhe von Terlan im Jahr 2024 untersucht worden sei, die von der STA zusammen mit dem Betreiber der Strecke evaluiert worden sei; aber der Bahnhof müsste leicht verschoben werden, um ihn für alle zugänglich zu machen. Die Schnellzüge würden auch durch Terlan fahren, daher brauche es zwei Gleise. Die Variante würde mehr Grund verbrauchen. Terlan sei ein wichtiger Bahnhof, der nicht deklassiert werden dürfe. Bei einer Bypasslösung könne Terlan nicht von jedem Zug angefahren werden.
Die Überarbeitung des neuen Logos der Landesverwaltung hat über drei Jahre gedauert und über 70.000 € gekostet, bemerkte Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit). „Es war uns ein Anliegen, es als identitätsstiftendes Symbol der Verwaltung behutsam weiterzuentwickeln und in eine zeitgemäße Formensprache zu übersetzen. Dabei haben wir uns an der Praxis von Verwaltungen anderer Regionen und Länder orientiert“, erklärte die Direktorin der Agentur für Presse und Kommunikation des Landes. Das amtliche Wappen mit dem Landesadler als Hoheitssymbol des Landes bleibt unangetastet. Wir hatten erst kürzlich den Dreierlandtag in Meran, wo viel über dessen Reform hin zu mehr Gewicht und mehr Sichtbarkeit diskutiert wurde. Es soll eine Art „Euregio-Parlament“ entstehen mit mehr politischen Befugnissen, so der Landeshauptmann. Dazu stellte Zimmerhofer folgende Fragen: Wird mit dieser Aktion nicht wieder das Trennende gefördert, als das Verbindende? Warum nicht auch ein gemeinsames Logo als identitätsstiftendes Symbol für die verschiedenen Verwaltungen der Europaregion?
Wie jede autonome Institution habe auch das Land ein eigenes Logo, um sich zu unterscheiden, antwortete LH Arno Kompatscher. Es gebe bereits ein gemeinsames Logo für die Euregio.
Seit dem 15.6. hat sich die Verkehrssituation am Bahnhof Bozen geändert, bemerkte Brigitte Foppa (Grüne): Die Buslinien 1, 7A, 10A/B halten nur noch in der Südtiroler Straße und nicht mehr am Bahnhof. Die Buslinie 10A/10B ist die einzige Stadtbuslinie in Bozen, die das Viertel Oberau und das Industriegebiet zwischen Bozen Süd und dem Schießstandplatz bedient; sie ist nun nicht mehr mit dem Bahnhof verbunden. Künftig wird diese Linie direkt zum Flughafen weiterfahren. Foppa hatte dazu folgende Fragen: Warum wurde beschlossen, wichtige Busverbindungen zum Bahnhof zu streichen und damit das Angebot zu reduzieren? Wie sieht der Mobilitätsplan aus, der dieser Entscheidung zugrunde liegt? Wie passt diese Entscheidung in das Bestreben, den öffentlichen Nahverkehr attraktiv, wettbewerbsfähig und barrierefrei zu gestalten? Wie wurde die Kommunikationsstrategie zu den Änderungen der Haltestellen rund um den Waltherpark gestaltet? Wurden die Anwohner der Südtiroler Straße über die Änderungen informiert? Wenn ja, wann und wie? Wenn nein, warum nicht? Warum wurde die direkte Stadtbusverbindung des gesamten Stadtteils Oberau zum Bahnhof gestrichen? Ist die Einführung einer zusätzlichen Linie zur direkten Verbindung von Oberau und Bahnhof geplant? Warum wurde die zukünftige Anbindung der Linie 10A/B an den Flughafen geplant, wenn die Einstellung der Verbindung zum Hauptbahnhof Bozen vorgesehen war? Warum werden nicht beide direkt miteinander verbunden? Wird die Anbindung an den Flughafen als wichtiger angesehen als die Anbindung an den Bahnhof und damit an den öffentlichen Nahverkehr?
Ein Teil der Fragen seien bereits beantwortet worden, erklärte LR Daniel Alfreider. Das Land habe die Gemeinde bereits auf mögliche Probleme hingewiesen, vor allem, wenn es übergemeindliche Verbindungen betreffe. Zu innerstädtischen Linien entscheide die Gemeinde. Es habe eine Aussprache mit der Gemeinde gegeben, und man hoffe, dass sich die Situation bald beruhigen werde.
Die Kleinkindbetreuung ist ein zentrales Element einer nachhaltigen und familienfreundlichen Politik in Südtirol, erklärte Maria Elisabeth Rieder (Team K). Dabei gilt es, die Verteilung dieser Angebote auf die einzelnen Gemeinden, die Trägerstrukturen sowie die finanzielle Unterstützung durch die öffentliche Hand transparent darzustellen, dies auch im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Betreuungsangebots. Rieder ersuchte die Landesregierung um die Beantwortung folgender Fragen: In welchen Gemeinden wird derzeit Kleinkindbetreuung (0–3 Jahre) angeboten? Welche finanziellen Mittel wurden 2024 und 2025 bereitgestellt und ausbezahlt? Wie viele Kinder werden derzeit in den einzelnen Betreuungsformen betreut? Wie viele Kleinkinder (0–3 Jahre) werden aktuell in den verschiedenen Betreuungsformen betreut? Wie viele Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren haben derzeit keinen Platz in einer Kitaeinrichtung, obwohl ein entsprechender Bedarf angemeldet wurde? Bitte um Angabe der Gesamtzahl sowie Aufschlüsselung nach Gemeinde. Welche Maßnahmen und Initiativen plant die Landesregierung zur Erweiterung des Angebots?
LR Rosmarie Pamer verwies in ihrer Antwort vielfach auf Anlagen, die sie der Fragestellerin übermitteln werde. Den Gemeinden wurden für den Dienst insgesamt 4,5 Mio. Euro an Beiträgen gewährt, 3,4 Mio. davon an Bozen. 600.000 Euro seien den privaten Einrichtungen für die Mehrkosten gewährt worden. Viele Kinder würden bei mehreren Einrichtungen angemeldet, daher seien Angaben über mangelnde Plätze nicht zuverlässig.
AM