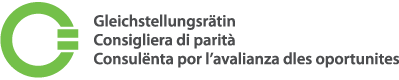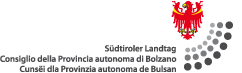News
Plenarsitzung - Aktuelle Fragestunde (1)
Fragen und Antworten zu Basisärzten, Pflegeeinstufung, Baustelle Brenner, KH-Parkplätze, Straßenverkehrsordnung, Covid-Impfstoff, Pride Month, Straßenbegleitgrün, Bozner Bushaltestellen u.a.
Zu Beginn der Sitzung lud Präsident Arnold Schuler die Abgeordneten zu einer Schweigeminute, um des Anfang Juni verstorbenen ehemaligen Abgeordneten Wilhelm Erschbaumer zu gedenken. Wilhelm Erschbaumer, geboren 1937, gehörte dem Landtag zwei Wahlperioden lang an, vom 13. Dezember 1973 bis zum 12. Dezember 1983. In der siebten Legislaturperiode war er Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Südtirol, in der achten Legislaturperiode Fraktionsvorsitzender der SPS und der Unabhängigen Sozialdemokraten USD. Er war auch Mitglied des Dritten Gesetzgebungsausschusses, zuständig für Finanz- und Wirtschaftsfragen. Im Regionalrat war er nicht nur Fraktionsvorsitzender, sondern auch Mitglied des ersten und zweiten Gesetzgebungsausschusses sowie der Wahlprüfungskommission.
Anschließend ging man zur aktuellen Fragestunde über.
Mit Februar 2025 wurde vom Südtiroler Sanitätsbetrieb eine Person als Allgemeinmedizinerin in Kurtatsch beschäftigt, die, wie in den vergangenen Jahren mehrmals in verschiedenen Orten, auch in Kurtatsch mit zahlreichen (unentschuldigten) Absenzen glänzte, berichtete Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit). Die Zuständigen im Sanitätsbetrieb hätten es verabsäumt, die Bewerberin bzw. deren Lebenslauf vorab genauer zu prüfen, und die Bürger von Kurtatsch standen wochenlang ohne Allgemeinmediziner da bzw. eine Vertretung musste den Dienst übernehmen. Knoll stellte dazu folgende Fragen: 1. Wie kann es sein, dass von Seiten des Südtiroler Sanitätsbetriebes eine Ärztin mit dieser Vorgeschichte beschäftigt wird? 2. Wie sieht die aktuelle Situation in Kurtatsch aus? Wurde durch den durchgeführten Wettbewerb die Stelle des Allgemeinmediziners nachbesetzt? 3. Welche finanziellen Nachteile bzw. Ausfallkosten ergeben sich durch die unentschuldigten Absenzen und die dadurch notwendige Vertretung für den Steuerzahler? 4. Was wird der Sanitätsbetrieb unternehmen bzw. welche Maßnahmen wird er implementieren, damit so ein Fall nicht wieder vorkommt?
Mit diesem Fall habe man sich bereits öfters beschäftigen müssen, nicht nur wegen der Absenzen, antwortete LR Hubert Messner. Die Vergabe für den befristeten Auftrag sei nach Kollektivvertrag erfolgt, der Sanitätsbetrieb habe den Erstgereihten nehmen müssen. Inzwischen sei die Stelle dauerhaft an eine andere Ärztin vergeben worden, der befristete Auftrag sei damit beendet. Solange es keine Disziplinarverfahren gebe, sei eine Entlassung nicht möglich gewesen.
Viele Familien, die einen Pflegefall zu Hause betreuen müssen, sind gezwungen, so schnell wie möglich eine private Pflegekraft („Badante“) einzustellen. Verlässlichen Hinweisen zufolge benötigt die Landesverwaltung für die Pflegeeinstufung zurzeit etwa 7 bis 8 Monate, erklärte Josef Noggler (SVP). Diese viel zu lange Verfahrensdauer wiederum bringt viele Familien in finanzielle Schwierigkeiten, da die pflegebedürftigen Personen meistens nur eine Mindestrente beziehen und sich deshalb ohne zusätzliche finanzielle Hilfe keine Pflegekraft leisten können. Es wäre dringend erforderlich, die Dauer zwischen Antragstellung und Pflegeeinstufung auf maximal 60 Tage zu reduzieren. Noggler schlug vor, dass die erste Pflegestufe zukünftig vom Hausarzt genehmigt wird: Die Hausärzte kennen die Pflegebedürftigkeit ihrer Patienten nämlich in der Regel sehr gut und somit könnte diese Maßnahme zu einer Verkürzung der Verfahrensdauer beitragen. Dies vorausgeschickt, stellte Noggler folgende Fragen an die Landesregierung: Wie viele Tage benötigt die Verwaltung durchschnittlich vom Datum der Antragstellung bis zum Datum der Pflegeeinstufung bzw. bis zur Auszahlung des Pflegegeldes? Ist die Landesregierung auch der Ansicht, dass die Verfahrensdauer reduziert werden sollte? Falls ja, welche Maßnahmen können angewendet werden, um die Dauer zu reduzieren? Wäre es denkbar, dass zumindest die erste Pflegestufe vom Hausarzt genehmigt wird? Falls nein, wird um genaue Auskunft gebeten.
Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Einstufung betrage derzeit 190 Tage, berichtete LR Rosmarie Pamer. Es seien inzwischen Maßnahmen ergriffen worden, um die Zeit zu kürzen, auch, um neuen staatlichen Vorgaben zu genügen. Die Genehmigung durch nur den Hausarzt werde aber nicht als zielführend erachtet. In Bezirken, wo die Einstufung in den Büros erfolgen könne und wo kein Personalmangel herrsche, sei die Zeit kürzer. Besonders lange Wartezeiten gebe es im Bezirk Meran. Sie hoffe, dass man die Zeit mit dem Teams, die jetzt vollständig seien, reduzieren könne.
Über Pfingsten war die Fahrt über den Brenner in Richtung Süden problematisch wegen der kilometerlangen Staus, bemerkte Franz Ploner (Team K). Während die Luegbrücke zweispurig befahrbar war, gab es eine Baustelle mit Einbahnverkehr im Grenztunnel Brenner , damit war das Verkehrschaos perfekt. Stimmen aus Nordtirol vermuten darin den “langen Arm” von Infrastrukturminister Salvini, um die Aufhebung des Nachfahrtverbots zu forcieren. Dazu richtete Ploner folgende Fragen an die Landesregierung: War die Landesregierung von der A22 in Kenntnis gesetzt worden, dass der Grenztunnel von 22 - 6 h nur einspurig befahrbar sei? Wenn nein, warum wurde man über solch gravierende Entscheidungen eingebunden? Gibt es zwischen Asfinag und A22 keinen direkten Austausch über geplante Spurensperrungen insbesondere im Grenzbereich? Wenn nein, warum nicht? Was war der Beweggrund der A22, den Tunnel einfach für die Nachtstunden einspurig zu führen? Wie rechtfertigt die Landesregierung diese unangemeldete Schließung gegenüber der Landesregierung Tirols bei einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres? “Während sich die Asfinag bemüht, die Verkehrsbehinderungen durch den Bau der Luegbrücke so gering wie möglich zu halten, führen Einbahnregelungen durch Baustellen auf Südtiroler Seite immer wieder zu langen Staus und die Schuld wird an Nordtirol abgewälzt”, was sagen Sie zu diesen Vorwürfen? Ploner bat schließlich um Aufstellung der Einbahnregelungen auf der Brennerautobahn zwischen Brenner und Bozen für den Zeitraum 2024 bis heute.
Er habe die Frage an die Autobahn weitergeleitet, aber es sei noch keine Antwort gekommen, bedauerte LR Daniel Alfreider. Man habe schon immer auf mehr Informationsaustausch gepocht, und gebe es leider noch Nachholbedarf.
Seitens der Bürger häufen sich Meldungen und Beschwerden über Geschehnisse auf der Landesstraße zur Seiser Alm, berichtete Andreas Colli (Wir Bürger). Am Kontrollpunkt in St. Valentin, am Beginn des Landschaftsschutzgebietes steht täglich seit Wochen und Monaten ein Mitarbeiter der Liftgesellschaft „Seiser Alm Bahn“, welcher sich in die Straße stellt, um das Weiterfahren in Richtung Seiser Alm zu verhindern und um die Fahrzeuge in Richtung Aufstiegsanlage nach Seis zu dirigieren. Angeblich soll dies auch lautstark und mit Nachdruck geschehen. Diese Handlungen sind mit den geltenden Bestimmungen nicht vereinbar. Das Kassationsgericht hat zweifelsfrei in mehreren Urteilen folgendes festgestellt: “Bloccare intenzionalmente un veicolo su una strada pubblica può essere considerato un reato, specificamente la violenza privata. Questo avviene quando si ostruisce il passaggio di un altro veicolo, costringendo così il conducente ad una privazione della libertà di movimento”. Colli stellte dazu folgende Fragen: Ist der Landesregierung diese illegale Arbeitsweise bzw. dieser Umstand bekannt, wo ein Mitarbeiter einer Liftgesellschaft systematisch einfach Menschen am Weiterfahren auf einer Landesstrasse hindert? Falls ja, wie will man das rechtfertigen? Was wird die Landesregierung unternehmen, um diesem illegalen Treiben bzw. dieser Straftat Einhalt zu gebieten?
Der Landesregierung sei der Fall nicht bekannt, antwortete LR Peter Brunner. Sobald man wisse, um welche Liftgesellschaft es gehe, könne man Nachforschungen anstellen. Wenn es sich um Landschaftsschutzgebiet handle, würden Sonderregeln gelten.
Anfang diesen Jahres wurde die experimentelle, auf Gentechnik beruhende Substanz KOSTAIVE-Zapomeran, ein sog. Covid-19-„Impfstoff“ auf sa-RNA-Basis (selbst amplifizierende mod-RNA) ohne die hierfür notwendigen Studien, mit denen eine Genotoxizität, Karzinogenität und Mutagenität ausgeschlossen werden könnten, zugelassen, berichtete Renate Holzeisen (Vita). Experten mit institutioneller Verantwortung - wie Dott. Maurizio Federico, Leiter des Nationalen Instituts für Global Health am ISS in Rom - sehen die konkrete Gefahr einer lang anhaltenden modRNA-Selbstamplifikation und der Übertragung der sa-modRNA auf andere Menschen u. die Umwelt generell. Aufgrund des konkreten Risikos des spreading ist jeder Südtiroler Bürger direkt und unmittelbar von der Zulassung dieser experimentellen Substanz betroffen. Wie bereits bei den nicht selbstreplizierenden modRNA-Covid-19-„Impfstoffen“ seit 4 Jahren laufend festgestellt, erzeugt das Spikeprotein im Körper massive Entzündungsvorgänge und den Zelltod. Im Beipackzettel von KOSTAIVE wird auf das Risiko einer Herzmuskelentzündung hingewiesen. Aufgrund des spreading-Risikos ist die Zulassung dieser Substanz eine klare Verletzung des Zustimmungserfordernisses für eine „medizinische“ Behandlung. Holzeisens Fragen an die Landesregierung: Beabsichtigt die Südtiroler Landesregierung, KOSTAIVE-Zapomeran in Südtirol zur Anwendung zu bringen? Haben Sie sich mit dem Risiko des spreading beschäftigt? Was gedenken Sie diesbezüglich zu tun?
Der neue Impfstoff sei zwar genehmigt, aber noch nicht im Handel, antwortete LR Hubert Messner. Daher werde man diesen Impfstoff nicht verwenden. Es gebe auch noch keine systematische Bewertung.
Der sogenannte „Verkehrsschilderwald“ sorgt nicht nur für eine Überregulierung im Straßenverkehr, sondern erschwert oft auch die intuitive Orientierung, überfordert VerkehrsteilnehmerInnen und verursacht erhebliche Kosten und Bürokratie, bemerkte Thomas Widmann (Für Südtirol) und stellte der Landesregierung dazu folgende Fragen: Wie viele vertikale Verkehrsschilder sind derzeit in Südtirol in Verwendung? Gibt es eine Erhebung/Datenbank hierzu? Wie haben sich Anzahl und Dichte der Verkehrsschilder in den letzten 10 Jahren hinsichtlich Zunahme bzw. Reduktion entwickelt? Welche Stellen sind für die Planung, Anbringung und Entfernung von Verkehrsschildern - differenziert nach Landes-/ Staats- /Gemeindestraßen zuständig? Wer ist für die regelmäßige Kontrolle der Verkehrsschilder zuständig und in welchen Intervallen erfolgen diese? Welche Sicherheitsbewertungen oder Leitlinien kommen bei der Aufstellung/ Entfernung von Verkehrsschildern zur Anwendung und wird auch die psychologische Wirkung auf VerkehrsteilnehmerInnen, z. B. Überforderung, Gewöhnungseffekt, beachtet? Wie werden redundante oder widersprüchliche Beschilderungen vermieden? Wie hoch sind die durchschnittlichen Kosten pro neuem Verkehrsschild (inkl. Aufstellung) und wie hoch waren die Gesamtkosten in den letzten 10 Jahren pro Jahr? Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den Schilderwald zu reduzieren? Gibt es in Südtirol Überlegungen zu alternativen Verkehrsmodellen wie „Shared Space“? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
In Südtirol gebe es schon seit langem ein Werbeverbot entlang der Straßen, erklärte LR Daniel Alfreider, es gebe nur Verkehrsschilder an Südtirols Straßen, aber auch diese seien zu viele: insgesamt 25.000 vertikale Schilder. Diese seien immer gemäß der Straßenverkehrsordnung aufgestellt worden. Die Verantwortung liege bei den jeweiligen Straßenbetreibern. Die Kosten pro Schild lägen zwischen 40 und 2.000 Euro. Man wolle auf jeden Fall so wenig wie möglich aufstellen. „Shared Space“ gebe es in einzelnen Gemeinden, aber auf Landesstraßen sei das nicht möglich. Man mache Rom immer wieder Vorschläge zur Verkehrsordnung, vor allem zu den Passstraßen, aber bisher mit wenig Erfolg.
Im Jahr 2019 hat die Landesregierung auf eine Anfrage von Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) zum vom Land Südtirol gepflegten Straßenbegleitgrün mitgeteilt, dass zur Fläche des Straßenbegleitgrüns keine verlässlichen Daten zur Verfügung stünden, sie aber auf rund 2.000 Hektar geschätzt werden könne. Leiter Reber reichte nun folgende Fragen nach: Kann die Fläche von rund 2.000 Hektar an Straßenbegleitgrün (Grünflächen am Straßenrand, Böschungen usw.) welche vom Land Südtirol gepflegt wird, inzwischen genauer definiert werden? Bzw. sind zusätzliche Flächen oder Pflegemaßnahmen dazugekommen? Wie hoch waren die Ausgaben für die Mäharbeiten und Pflege des Straßenbegleitgrüns in den Jahren 2024, 2023 und 2022 insgesamt? Wie gliedern sich diese Kosten in Personalkosten, Treibstoffkosten, Kosten für Verbrauchsmaterialen, Amortisierungskosten für Geräteträger oder in Ausgaben für die Erneuerung des Fuhrparks etc.? Wie viele Mitarbeiter wurden dafür eingesetzt? Die Mäharbeiten hängen sowohl mit den klimatischen Bedingungen in den unterschiedlichen Höhenlagen und mit den Niederschlägen zusammen. Kann die Landesregierung mitteilen, wie oft das Straßenbegleitgrün in den Tallagen entlang der Vinschgauer Staatsstraße SS38, entlang der Brennerstaatsstraße SS12 im Unterland, Eisack- und Wipptal und entlang Pustertaler Staatsstraße SS49 jährlich gemäht wird? Werden auf den vom Land Südtirol verwalteten Straßen gezielt Hecken als Lärmschutzmaßnahme gepflanzt oder in Kombination mit anderen Formen des Lärmschutzes zur Reduzierung des Verkehrslärms eingesetzt? Wenn ja, auf welchen Straßenabschnitten?
Er bedauere, dass er so viele und so detaillierte Fragen nicht in so kurzer Zeit beantworten könne, erklärte LR Daniel Alfreider. Er werde die Antwort nachreichen.
Das Land Südtirol beteiligt sich auch heuer wieder mit diversen Aktionen am so genannten „Pride Month“, stellte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) fest. Während des gesamten Monats Juni stellen die Südtiroler Landesmuseen „queere Geschichte, Lebensrealitäten und kulturelle Ausdrucksformen in den Mittelpunkt“. Auf den Internetseiten der Südtiroler Landesmuseen sind deren Logos in den Regenbogenfarben gehüllt. Der Himmel über dem Schloss Tirol ist im Internet in den Regenbogenfarben eingefärbt. Und im realen Leben hängt das Schloss Tirol – um die Buntheit abzurunden – sogar zwei so genannte progressive Regenbogenfahnen aus. Kritische Beobachter halten derartige Aktionen von Seiten der Landesmuseen für übertrieben und fühlen sich brüskiert. Knoll stellte dazu folgende Fragen an die Landesregierung: Gibt es von Seiten der Landesregierung eine Weisung oder eine Empfehlung an die Landesämter bzw. an die Landesverwaltung, sich am so genannten „Pride Month“ durch konkrete Aktionen zu beteiligen? Standen den Landesmuseen Südtirol eigene Geldmittel für die Beteiligung am so genannten „Pride Month“ zur Verfügung? Falls ja, in welcher Höhe? Hält es die Landesregierung für begrüßenswert, wenn an öffentlichen Gebäuden Fahnen ausgehängt werden, von denen klar eine ideologische Botschaft und eine Reihe von daraus resultierenden politischen Forderungen ausgehen?
Seit 2023 sei das Land Teil des Netzwerks, wie auch andere öffentliche Einrichtungen, antwortete LH Arno Kompatscher. Das Land zeige damit Flagge gegen alle Formen der Diskriminierung. Für die Beteiligung habe das Land 1.920 Euro ausgegeben. Die Initiative stehe für Inklusion, Vielfalt und Nichtdiskriminierung, Ziele, die auch im Koalitionsprogramm stünden. Das bedeute nicht, dass man alle Initiativen, die sich unter diese Fahne stellten, mittrage. Auch der Tiroler Fahne würden viele Bedeutungen zugeschrieben.
Das Problem seien nicht die Rechte oder die Nichtdiskriminierung, entgegnete Knoll, sondern die Verknüpfung mit bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Zielen. Man stehe zu den genannten Zielen, für die die Fahne stehe, antwortete LH Kompatscher, nicht mit allem, was hineineinterpretiert werde.
Der Hauptparkplatz des Krankenhauses in Bozen, dessen Einfahrt sich an der Kreuzung zwischen der Lorenz-Böhler-Straße und der Via Vittorio Veneto befindet, kostet 1,50 Euro pro Stunde: ein nicht unerheblicher Betrag für diejenigen, die täglich Verwandte oder Freunde im Krankenhaus besuchen möchten, meinte Brigitte Foppa (Grüne). Tatsächlich müssen oder möchten viele Menschen ihre Angehörigen täglich versorgen und müssen daher einen längeren Aufenthalt im Krankenhaus einplanen. Wenn der Besuch mehrere Stunden pro Tag und mehrere Tage pro Woche dauert, können die Parkgebühren erheblich werden. Das Problem stellt sich auch in anderen Krankenhäusern in Südtirol. Ein Krankenhausparkplatz sollte für alle zugänglich und erschwinglich sein. Foppas Fragen dazu: Wer legt die Parkgebühren in den Südtiroler Krankenhäusern fest? Kann die Landesregierung Einfluss auf die Parkgebühren nehmen und wenn ja, wie? Welche Parkvergünstigungen gibt es für Krankenhäuser in Südtirol? Ist kostenloses Parken möglich? Wenn ja, wer hat Anspruch darauf? Wie funktioniert die Informationspolitik? Wie werden Personen, die Anspruch auf eine Vergünstigung oder kostenloses Parken haben, informiert?
LH Hubert Messner erklärte, dass die Tarife seit 2023 nicht mehr von den einzelnen Krankenhäusern festgelegt werden, sondern vom Sanitätsbetrieb. Man arbeite noch an einem einheitlichen Tarifsystem für alle Krankenhäuser. Es gebe Gebührenbefreiungen für bestimmte Kategorien. Foppa plädierte dafür, keine Gebühren für Krankenhausparklätze zu verlangen. Man sei nicht freiwillig dort.
Mit dem 15.6. wurden die Bushaltestellen vor dem Bahnhof Bozen abgeschafft, sodass die Fahrgäste nun gezwungen sind, weiter entfernte Haltestellen wie die in der Südtiroler Straße zu erreichen, stellte Paul Köllensperger (Team K) fest. Am 18.6. hat der Gemeinderat von Bozen einen Antrag des Team K genehmigt, in dem deren Wiederherstellung gefordert wird. Diese Entscheidung steht im Widerspruch zu den Zielen der Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und der nachhaltigen Mobilität und benachteiligt insbesondere ältere Menschen, Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Reisende mit Gepäck und Touristen. Es kommt der Verdacht auf, dass die öffentliche Hand vor zehn Jahren im Dienste des Waltherparks stand, und man fragt sich, ob sie dies auch heute nach dem Zusammenbruch von Benko noch tut. Um vom Bahnhof zu den Haltestellen in der Südtiroler Straße zu gelangen, muss man etwa 300 Meter zu Fuß gehen und dabei zwangsläufig am Kaufhaus vorbeikommen (und morgen vielleicht sogar hindurchgehen): ein Geschenk an diejenigen, die dort investiert haben? Köllenspergers Fragen dazu: Warum sah das Stadtbahnprojekt eine Trasse durch die Bahnhofstraße vor (und verstieß damit gegen den PSU ), während dies für Busse nicht der Fall war? Welche Gründe haben zu der Entscheidung geführt, den Großteil der Buslinien vom Bahnhof weg zu verlegen? Zieht das Ressort in Zusammenarbeit mit Sasa die Möglichkeit in Betracht, eine direkte und funktionale Verbindung wiederherzustellen?
Wenn man die Tram hätte, hätte man auch weniger Verkehrsprobleme in Bozen, bemerkte LR Daniel Alfreider. Sein Ressort habe vor den neuen Bushaltestellen gewarnt und der Gemeinde auch Auflagen gemacht. Aber die Gemeinde wollte den Bahnhofpark gänzlich vom Verkehr befreien. Die neue Gemeindeverwaltung habe nun viel Arbeit vor sich, um die entstandenen Probleme zu beheben.
AM