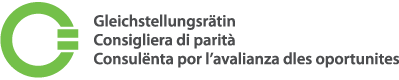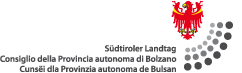News
Plenarsitzung - Lehrergehälter, Integrationslehrer, Zweisprachigkeit, Josefitag, Dolomitenpässe, Lueg-Brücke
Anträge von Freier Fraktion, Team K, Süd-Tiroler Freiheit, Grünen und Für Südtirol
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Staatsgesetzes zur „Par Condicio“, die im Vorfeld der Stichwahlen und der nächsten Volksabstimmungen (8./9. Juni) gelten, berichtet der Pressedienst in neutraler Form aus der Plenarsitzung, ohne Namen von Kandidaten und ohne Themen der Volksabstimmung.
Der Landtag hat am Nachmittag die Debatte zum Beschlussantrag Nr. 266/25: Lehrberufe: Gehälter & Kaufkraft stärken (eingebracht vom Abg. Leiter Reber am 18.04.2025) wieder aufgenommen. Die Forderung (Ersetzungsantrag vom 8.5.2025, der auch von LR Achammer unterzeichnet wurde): Der Landtag verpflichtet die Landesregierung, 1. – gemeinsam mit den Gewerkschaften ein Konzept auszuarbeiten, wie die Gehälter der Lehrpersonen über die strukturelle Inflationsanpassung hinaus schrittweise angehoben werden können, unter anderem indem ein zweiter Grundlohn, also ein Landesgrundlohn neben dem staatlichen, vorgesehen wird, um so auch im Wettbewerb mit benachbarten Regionen bestehen zu können. Das Konzept soll innerhalb des Jahres auch dem Landtag übermittelt werden; 2. - zusätzliche Benefits (entweder ökonomische oder in der Arbeitszeitgestaltung) für Lehrpersonen vorzusehen, welche an besonders herausfordernden Standorten mit heterogenen Klassenverbänden und großer Sprachkomplexität arbeiten; 3. - im Zuge der Verhandlungen mit den Gewerkschaften auch über Benefits wie eine Dozentenkarte endgültig zu entscheiden.
Harald Stauder (SVP) unterstrich die Bedeutung des Lehrerberufs, der mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert sei. Lehrer sähen sich auch als Vermittler von Werten eingebunden, die eigentlich von den Familien kommen sollten. Man müsse schauen, dass die Besten diesen Beruf ergreifen. Mehr Leistung sollte auch monetär sichtbar werden. Da müsse man schauen, was notwendig und was rechtlich möglich sei. Mit der Zielrichtung des Antrags sei man vollkommen einverstanden, deshalb gebe es Zustimmung.
Es werde Jahre brauchen, um das alte Lohnniveau wieder zu erreichen, erklärte Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion), daher könne der Antrag auch die nächste Legislatur betreffen.
Sandro Repetto (Demokratische Partei) zeigte sich verwundert, dass nicht auch LR Galateo unterschrieben habe. Es gehe auch um die italienische Schule.
Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, meinte Maria Elisabeth Rieder (Team K). Man könne auch über Benefits reden, der erste Schritt müsse aber das Grundgehalt sein.
Arno Kompatscher (SVP) erklärte, dass eine Aufwertung des Lehrberufs auch im Koalitionsabkommen stehe. Er sei auch dafür, dass man zuerst das Grundgehalt angehe. Man müsse auch an zusätzliche Vorteile für jene denken, die mehr Stunden leisteten, etwa im Sommer.
Marco Galateo (Fratelli d’Italia) teilte mit, dass er den Antrag inzwischen mitunterzeichnet habe.
Magdalena Amhof (SVP) berichtete über die jüngsten Verhandlungen über die Einmalzahlung und über die 75 Millionen für den Inflationsausgleich, zusätzlich zum Abo für Verkehr und Sanipro-Leistungen. Wann die Verhandlungen abgeschlossen sein werden, sei schwer zu sagen, aber sie kämen gut voran. Auch mit dem Rechnungshof seien Termine vereinbart, und dann würden die Verhandlungen über die Inflationsanpassung der Gehälter aller Beschäftigten beginnen. Es sei wichtig, die Grundgehälter anzupassen, damit man auch rentenfähige Elemente habe.
Man müsse jetzt liefern, räumte auch LR Philipp Achammer ein. Man liege im Gefälle über Italien, aber unter Österreich und deutlich unter der Schweiz, die man nie erreichen werde. Am 1. April habe die Landesregierung beschlossen, die Verhandlungen zu den drei Tarifverträgen in der Schule aufzunehmen, die unterschiedlich strukturiert seien. Am 20. Mai werde es wieder ein Treffen mit den Gewerkschaften geben. Seit 2008 seien keine Anpassungen mehr vorgenommen worden, und das sei deutlich zu lang. Das Grundgehalt sollte Priorität haben. Bei der Organisation des Stundenkontingents stehe man im Ländervergleich nicht schlecht da. Er betonte schließlich, dass die gesamte Landesregierung ein Bekenntnis zur Lohnerhöhung abgegeben habe. Innen- und Außenansicht seien im Bildungsbereich unterschiedlich; man müsse mehr an der Außenansicht arbeiten und erklären, warum die Erhöhung notwendig ist.
Andreas Leiter Reber freute sich über die breite Zustimmung. Die Reallöhne seien über viele Jahre gesunken, und man müsse endlich aufholen.
Die Prämissen des Antrags wurden abgelehnt, der beschließende Teil wurde mit 31 Ja einstimmig angenommen.
Beschlussantrag Nr. 229/25: Stimmrecht für Mitarbeiter:innen der Integration in den Klassenräten und deren Recht auf Zugang zum digitalen Klassenbuch (eingebracht von Abg. Ploner A., Köllensperger, Rieder und Ploner F. am 21.02.2025 und ersetzt am 9.4.2025). Der Landtag möge die Landesregierung verpflichten, 1. die entsprechenden Bestimmungen dahingehend anzupassen, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Teilnahme an den Sitzungen des Klassenrates grundsätzlich zu ermöglichen, auch mit Stimmrecht, wenn es um die Interessen der ihnen zugewiesenen Schüler:innen geht, ausgenommen die Bewertungen; 2. in der Autonomie der Schule den Zugang der Mitarbeiter:innen zum digitalen Register zu regeln in Bezug auf die ihnen zugewiesenen Schüler:innen.
Der Antrag war bereits am 13.03.2025 diskutiert und dann vertagt worden.
Es gebe immer mehr Diagnosen an den Schulen, bemerkte Alex Ploner (Team K), die Integrationslehrer seien zur wichtigen Figur geworden und möchten dementsprechend in die Entscheidungen eingebunden werden. Der Zugang zum Register falle zwar unter die Schulautonomie, aber das sollte man doch flächendeckend ermöglichen.
Die pädagogischen Tätigkeiten fielen nicht unter die Aufgaben der Integrationsmitarbeiter, erklärte LR Philipp Achammer, daher müsse man auch abwägen, zu welchen Themen diese Stimmrecht bekommen sollten. Die Schulen bemühten sich sehr um Integration, aber in manchen Fällen sei die Entscheidung schwierig, z.B. wenn es um einen Lehrausflug gehe, bei dem auch medizinische Unterstützung notwendig sei. Einzelfälle gerieten zwar in die Schlagzeilen, aber im überwiegenden Teil finde sich eine Lösung. Man habe das Kontingent an Integrationsmitarbeitern aufgestockt, und man bemühe sich auch, für Kontinuität zu sorgen.
Alex Ploner erkannte die Bemühungen an und dankte für die signalisierte Zustimmung.
Der Antrag wurde mit 31 Ja einstimmig angenommen.
Beschlussantrag Nr. 264/25: Anpassung der Zweisprachigkeitsprüfung an die Berufsbedürfnisse (eingebracht von den Abg. Ploner F., Köllensperger, Ploner A. und Rieder am 18.04.2025). Der Landtag verpflichtet die Landesregierung, 1. neue Wege zur Überprüfung der erforderlichen Deutsch- und Italienischkenntnisse, die zur Berufsausübung in den akademischen Heilberufen erforderlich sind, zu beschreiten und das allgemeinsprachliche B2- Niveau laut GER vorzuschreiben. Für das C1- Niveau muss eine fachbezogene Sprachprüfung durchgeführt werden; 2. zum Erreichen der fachsprachlichen Kenntnisse Intensivkurse zur medizinischen Fachsprache am Arbeitsplatz vorzusehen und zum Erlernen der zweiten Landessprache Peer-Tutoring am Arbeitsplatz anzubieten; 3. verpflichtend vorzuschreiben, extern an international anerkannten Sprachschulen erworbene Sprachzertifikate durch das Amt für Zweisprachigkeits- und Ladinischprüfung zu nostrifizieren.
Seit 1977 werden in Südtirol Zweisprachigkeitsprüfungen nach den Kompetenzstufen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) durchgeführt (A2, B1, B2, C1), schickte Franz Ploner (Team K) voraus. Es gibt Beschwerden über mangelnde Sprachkenntnisse im Gesundheitswesen. 449 Mitarbeitende haben keinen Zweisprachigkeitsnachweis. Berichtet wird auch über einsprachige Formulare und gefälschte Sprachzertifikate. Spezialisierte Sprachprüfungen für medizinische Fachbereiche werden seit Herbst 2024 vom Sanitätsbetrieb angeboten, das sei anzuerkennen. Es wurde auch die Zeitspanne für den Erwerb des Zweisprachigkeitsnachweises C1 von zwei auf fünf Jahre erhöht, muss aber jetzt wegen römischen Einsprüchen auf drei Jahre reduziert werden. Ein Blick nach Norden zeigt, dass im deutschen Sprachraum für nicht-deutsche Ärztinnen/Ärzte der Besitz des B2-Sprachnachweises und eine zusätzliche fachspezifische Prüfung auf C1-Niveau ausreichend sind.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) stellte einen Zusammenhang mit der Ansässigkeitsklausel für das Wahlrecht vor. Nach der Reform des Statuts könne man nach zwei Jahren hier wählen, müsse die zweite Sprache aber erst nach drei Jahren beherrschen. Es gehe bei dem Problem auch um die Bereitschaft, die andere Sprache zu lernen. Jeder marokkanische Straßenverkäufer könne seine Ware in zehn Sprachen anbieten. Auch im Saal gebe es Leute mit Zweisprachigkeitsattest, aber ohne Beherrschung der deutschen Sprache.
Die Zweisprachigkeit sei ein wichtiges Thema, meinte Zeno Oberkofler (Grüne), aber für die Sanität sei sie eine Herausforderung, da sie sich schwertue bei der Personalsuche. Sanitätspersonal finde anderswo niedrigere Lebenshaltungskosten, höhere Gehälter und geringere Auflagen. Man müsse neue Wege finden, etwa Sprachvermittler, aber Ploners Vorschlag gehe auch in die richtige Richtung.
Paul Köllensperger (Team K) erinnerte an den Fall eines Hausarztes, der nach drei Jahren gehen musste, weil er zwar Deutsch konnte, aber die Sprachprüfung nicht schaffte. Es wäre falsch, die Zweisprachigkeitspflicht aufzugeben, aber man müsse Wege finden, um die Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Ärzte müssten nicht Goethe übersetzen, sie müssten mit ihren Patienten reden können und die Fachbegriffe in der anderen Sprache kennen. Das sei in Deutschland und Frankreich schon lange so.
Die Aufenthaltsdauer sage nichts über die Sprachbeherrschung aus, bemerkte Waltraud Deeg (SVP), manche würden sich auch abschotten. Die Zweisprachigkeit im Gesundheitswesen müsse gewährleistet werden, der Arzt müsse mit dem Patienten auch ein menschliches Gespräch führen können, nicht nur Fachbegriffe aufzählen. Es sei auch zu sagen, dass viele mit Zweisprachigkeitsdiplom nicht zweisprachig seien.
Man müsse überlegen, ob man einen deutschen, italienischen oder anderssprachigen Arzt wolle oder mehr Ärzte, meinte Maria Elisabeth Rieder (Team K). Für sie und für viele andere Südtiroler sei die Zweisprachigkeitsprüfung eine Herausforderung gewesen. Heute aber gebe es viele mit Sprachdiplom, aber ohne Zweisprachigkeit.
Die Zweisprachigkeit sei ein Grundpfeiler der Autonomie, erklärte LR Hubert Messner, die Nachweise dafür seien rechtlich festgelegt. Für die befristete Aufnahme gebe es verschiedene Ausnahmen für drei bis fünf Jahre. Er verstehe Ploners Anliegen, aber das könne man nicht über einen Beschlussantrag regeln. Es sei die Frage, ob der Ansatz - allgemeine Sprachkenntnis auf niedrigerem, Fachsprache auf höherem Niveau - praktisch umsetzbar oder sogar auf andere Berufe anwendbar wäre. Es gebe bereits viele Sprachkurse mit Fokus auf die Fachsprache. Es habe zwei Fälle von gefälschten Sprachzertifikaten gegeben, die übrigens vom Amt für Zweisprachigkeit aufgedeckt wurden. Messner sprach sich schließlich gegen den Antrag aus.
Mit seinem Antrag wollte er die Landesregierung zum Nachdenken bewegen, erwiderte Franz Ploner. Für die 449 ohne Zertifikat wäre es vielleicht sinnvoller gewesen, ein allgemeines B2-Niveau und ein Fachsprachenniveau C1 zu verlangen. B2 sei umgangssprachliches Niveau und damit genau richtig für ein Patientengespräch.
Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt.
Begehrensantrag Nr. 06/24: 19. März, Heiliger Josef: Josefitag wieder als Feiertag einführen! (eingebracht von den Abg. Atz, Knoll, Zimmerhofer und Rabensteiner am 20.02.2024). 1. Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung, dass das Fest des Heiligen Josefs (19. März) in Südtirol wieder als gesetzlicher Feiertag anerkannt wird. 2. Der Südtiroler Landtag fordert das römische Parlament und die italienische Regierung in Rom zum Erlass einer entsprechenden Maßnahme auf, dass in Südtirol der Tag des Heiligen Josefs (19. März) als Feiertag begangen werden kann. 3. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Einführung des Josefitages als schulfreien Tag sowie als freien Tag für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer aus. Der Südtiroler Landtag fordert die Landesregierung auf, diesbezügliche Gespräche mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen fortzuführen. 4. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung, mit Vertretern aus Kirche, Gesellschaft und Politik zu prüfen, wie ein lokaler Josefi-Feiertag gebührend begangen werden kann.5. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol neben dem Josefitag am 19. März auch Christi Himmelfahrt und Fronleichnam wieder als Feiertage eingeführt werden. 6. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich dahingehend einzusetzen, dass die Kompetenz für die Ernennung von Feiertagen in Südtirol – aufgrund der historischen, religiösen und kulturellen Unterschiede – an die Autonome Provinz Bozen übertragen oder eine entsprechende Sonderregelung geschaffen wird.
Der Antrag war bereits am 11.03.2025 diskutiert und dann vertagt worden.
Die Einbringer haben dazu eine neue Fassung vorgelegt: Der Südtiroler Landtag erneuert die Forderung, dass das Fest des Heiligen Josefs (19. März) in Südtirol wieder als gesetzlicher Feiertag anerkannt wird. Der Südtiroler Landtag fordert das römische Parlament und die italienische Regierung in Rom zum Erlass einer entsprechenden Maßnahme auf, dass in Südtirol der Tag des Heiligen Josefs (19. März) als Feiertag begangen werden kann. Der Südtiroler Landtag spricht sich für die Einführung des Josefitages als schulfreien Tag für Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus. Der Südtiroler Landtag ersucht die Landesregierung und das Präsidium, gemeinsam mit den Sozialpartnern in Dialog zu treten, um diese aufzufordern, einen einvernehmlichen und lösungsorientierten Vorschlag zur Umsetzung des Josefstages als Landesfeiertag auszuarbeiten. Der Südtiroler Landtag beauftragt die Landesregierung und das Präsidium eine Anhörung der Vertreterinnen und Vertreter der Sozialpartner zum vorgelegten Vorschlag zu organisieren. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich dahingehend einzusetzen, dass in Südtirol neben dem Josefitag am 19. März auch Christi Himmelfahrt und Fronleichnam wieder als Feiertage eingeführt werden. Der Südtiroler Landtag fordert das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich dahingehend einzusetzen, dass die Kompetenz für die Ernennung von Feiertagen in Südtirol — aufgrund der historischen, religiösen und kulturellen Unterschiede — an Provinz Bozen übertragen oder eine entsprechende Neuregelung geschaffen wird.
Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit) wies darauf hin, dass der Änderungsantrag auch von Abgeordneten von Team K, PD, Vita und von den Abg. Noggler und Locher von der SVP mitunterzeichnet worden sind.
SVP-Fraktionschef Harald Stauder stellte klar, dass die SVP einen eigenen Vorschlag hat, der in dieser Sitzung diskutiert wird, und deshalb denjenigen der STF nicht unterstützen wird. Das Problem liegt hauptsächlich bei den Sozialpartnern, und deshalb verlangt der SVP-Antrag von ihnen einen Vorschlag für eine realistische Maßnahme, ohne Forderungen an das italienische Parlament.
Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) betonte, dass man das Ziel auch ohne Rom erreichen könne. Damit hätte man mehr Glaubwürdigkeit.
LR Magdalena Amhof erinnerte an die Gespräche mit den Sozialpartnern zum Thema. Mit diesen müsse man reden, es brauche keinen Antrag im Landtag. Einige Wirtschaftskategorien seien mit dem Vorschlag nicht einverstanden, daher sei der Ansatz des Antrags von Stauder sinnvoller.
Myriam Atz wies darauf hin, dass ihr Antrag auch ein Gespräch mit den Sozialpartnern fordere.
Der Antrag wurde in mehreren Abstimmungen zu den einzelnen Punkten mehrheitlich abgelehnt.
Am Nachmittag wurde auch die Debatte zum Beschlussantrag Nr. 258/25: Die Dolomiten und ihre Bewohner:innen brauchen endlich eine Pause (eingebracht von den Abg. Foppa, Rohrer und Oberkofler am 17.04.2025) wieder aufgenommen. Dazu wurde ein Ersetzungsantrag vorgelegt, der auch von Harald Stauder mitunterzeichnet wurde: Der Landtag beauftragt die Landesregierung, 1) jährlich einen Bericht zum Verkehr auf den Pässen zu erstellen; 2) die Regierung in Rom auffordern, die gesetzlichen Voraussetzungen für Verkehrssteuerung und -reduktion in sensiblen Gebieten zu schaffen (z.B. Maut, Kontingentierung, Fahrverbote für einzelne Fahrzeugkategorien, Ausnahmen für emissionsfreie Fahrzeuge, usw.); 3) sich beim Regierungskommissariat einzusetzen, die Kontrollen sowohl durch fixe Radarsysteme als auch durch Polizeistreifen auf den Pässen zu verdichten. Neben Geschwindigkeitskontrollen sollen auch vermehrt Dezibel-Kontrollen durchgeführt werden. Hierbei sind neben den staatlichen Ordnungskräften auch die Ortspolizeikräfte gefragt; 4) den Austausch aller betroffenen Landesämter mit den Gemeinden, welche von der Verkehrsproblematik in den sensiblen Gebieten betroffen sind zu intensivieren, um die Gemeinden bei der Konkretisierung der Konzepte und Umsetzung der Maßnahmen zur Reduzierung und Verlagerung des Verkehrs zu unterstützen.
Es sei eine Abschwächung des ursprünglichen Antrags, räumte Brigitte Foppa (Grüne) ein. Es sei aber immerhin ein Versprechen, dessen Umsetzung man in einem Jahr überprüfen wolle.
LR Daniel Alfreider zeigte sich mit der neuen Fassung einverstanden. Es sei klar, dass man etwas unternehmen müsse, und die neue Straßenverkehrsordnung erschwere die Kontrollen. Man werde beim Regierungskommissariat und in Rom vorstellig werden, denn es brauche die gesetzlichen Rahmenbedingungen, um gewisse Dinge tun zu können.
Der Antrag wurde mit 28 Ja und 2 Enthaltungen angenommen.
Beschlussantrag Nr. 256/25: Verkehrssituation am Brennerkorridor: Auswirkungen der Sanierung der Luegbrücke und notwendige Maßnahmen (eingebracht von Abg. Widmann am 16.04.2025). Der Landtag möge die Landesregierung verpflichten, 1. eine detaillierte Analyse der bestehenden Schienenkapazitäten und -potenziale für eine verstärkte Verlagerung des Lkw-Verkehrs während der Bauphase der Luegbrücke zu veranlassen und die Ergebnisse noch vor dem Dreierlandtag im Juni 2025 den Abgeordneten des Südtiroler Landtages zur Verfügung zu stellen; dabei soll insbesondere geprüft werden, welche kurzfristigen Maßnahmen ohne große bauliche Eingriffe realisiert werden können, um die Kapazitäten der Schiene zu maximieren; zudem sollen Anreize wie temporäre Preissenkungen für den Schienengüterverkehr geprüft werden; 2. die Nutzung der Rollenden Landstraße (RoLa) als eine von mehreren kurzfristigen Maßnahmen zur Entlastung des Brennerkorridors zu prüfen und zu optimieren, wobei insbesondere Effizienz und Wirtschaftlichkeit dieser Lösung berücksichtigt werden sollen – die Ergebnisse sind ebenfalls noch vor dem Dreierlandtag im Juni 2025 vorzulegen; 3. auf zwischenstaatlicher Ebene tätig zu werden, um die Regierungen von Tirol und Trentino dazu zu ersuchen, allen Abgeordneten der drei Landtage regelmäßig und transparent Informationen über den Baufortschritt an der Luegbrücke sowie über getroffene Maßnahmen zur Verkehrslenkung bereitzustellen, um eine koordinierte und abgestimmte Vorgehensweise im Sinne des Alpenraums zu ermöglichen.
Seit dem 1. Januar 2025 ist die Luegbrücke in Nordtirol aufgrund von Sanierungsarbeiten bis Ende 2027 großteils nur einspurig befahrbar, erklärte Thomas Widmann (Für Südtirol). Dies verschärft die Verkehrssituation auf der Brennerachse erheblich. Die Einschränkungen führen zu Rückstaus, zusätzlichen Emissionen und negativen Effekten auf die regionale Wirtschaft, den Tourismus und den Pendlerverkehr in Südtirol.
LR Daniel Alfreider sprach sich, auch nach Rücksprache mit seinem Ressort, gegen den Antrag aus. Die Lueg-Brücke sei eine von mehreren Baustellen. Man stehe intensiv in Austausch mit Tirol, und es seien Erleichterungen ermöglicht worden. In den letzten Wochen habe der Verkehr stark zugenommen. Aktuelle Informationen zur Baustelle gebe es online. Die derzeitigen Daten zur RoLa seien nicht ermutigend, und die derzeitige Brennerschiene sei nicht geeignet für einen Ausbau dieser Möglichkeit. Die Unkenntnis über die unterschiedlichen Feiertage in den Ländern führe auch zu Überlastungen, daher wolle man den grenzüberschreitenden Informationsfluss verstärken. Notwendig sei auch eine einheitliche Regelung für den gesamten Korridor.
Replik des Einbringers und Abstimmung wurden vertagt.
Anschließend wurde mit Gesetzentwürfen und Anträgen der Mehrheit fortgefahren.
AM