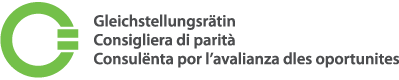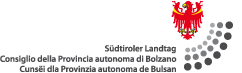News
Plenarsitzung - Dorfgasthäuser, Autismus, Lehrergehälter
Anträge von Süd-Tiroler Freiheit, Vita und Freier Fraktion
In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Staatsgesetzes zur „Par Condicio“, die im Vorfeld der Stichwahlen und der nächsten Volksabstimmungen (8./9. Juni) gelten, berichtet der Pressedienst in neutraler Form aus der Plenarsitzung, ohne Namen von Kandidaten und ohne Themen der Volksabstimmung.
Beschlussantrag Nr. 260/25: Ortskerne beleben, Wirtshauskultur fördern! (eingebracht von den Abg. Rabensteiner, Knoll, Atz und Zimmerhofer am 17.04.2025). 1. Die Landesregierung wird beauftragt, die bestehenden Förderrichtlinien für gastgewerbliche Nahversorgungsbetriebe dahingehend zu überarbeiten, dass Betriebe im Ortszentrum auch dann gefördert werden können, wenn sich im Umkreis von einem Kilometer weitere gastronomische Betriebe befinden, diese jedoch nicht im Ortskern liegen. 2. Die Landesregierung wird aufgefordert, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Möglichkeiten steuerlicher Erleichterungen (z.B. IRAP und IMU) oder reduzierter Abgaben für gastronomische Betriebe im Ortskern zu prüfen, um deren wirtschaftliche Tragfähigkeit langfristig zu sichern. Die erarbeiteten Informationen sowie die Informationen zur Förderung von Dorfgasthäusern im Allgemeinen sollen allen Gemeinden zur Verfügung gestellt werden. 3. Die Landesregierung wird aufgefordert, mit den Gemeinden und Verbänden (hgv, hds) zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass im Sinne der Bevölkerung ein zentraler Treffpunkt im Ort als Dorfgasthaus/Dorfbar erklärt und gefördert wird. In strittigen Fällen wird den Gemeinden ein Mitspracherecht eingeräumt, welche Bar bzw. welches Gasthaus effektiv von der Bevölkerung als Dorfgasthaus/Dorfbar genutzt wird. 4. Die Landesregierung wird beauftragt, in den Förderkriterien vorzusehen, dass geförderte Betriebe auch außerhalb der Saison, im jeweiligen Ort, den Betrieb für die Bevölkerung offenhalten müssen. Die betroffenen Zeiträume, außerhalb der Saison sollen in Abstimmung mit den Verbänden (hds, hgv) festgelegt werden. 5. Die Landesregierung wird beauftragt, gemeinsam mit der Post AG zu prüfen, ob Dorfgasthäuser künftig auch als Post-Partnerbetriebe zur Abgabe und Abholung von Paketen und Sendungen fungieren können. Dies würde sowohl der Post als auch den Gasthäusern Vorteile bringen. 6. Die Landesregierung wird beauftragt, ein gestaffeltes Fördersystem mit unterschiedlichen Beitragshöhen einzuführen: ¿ Erste Stufe: Förderung für Bars, die ausschließlich Getränke anbieten; ¿ Zweite Stufe: Höhere Förderung für Betriebe, die zusätzlich ganzjährig kleine Speisen (z. B. Toast, belegte Brote, Pizzaschnitten, Brunch, Kuchen, Eis) anbieten; ¿ Dritte Stufe: Höchste Förderung für Dorfgasthäuser, die ganzjährig mindestens ein warmes Mittagsmenü, auch Arbeitermenü, im Angebot haben. Die Kontrolle der Einhaltung dieser Förderkriterien obliegt den Gemeinden und Verbänden.
Laut Hannes Rabensteiner (Süd-Tiroler Freiheit) gibt es in vielen Orten keine Gasthöfe und Kneipen mehr im Ortskern oder sie kämpfen um ihr Überleben, obwohl sie eine wichtige Funktion im Ortsleben erfüllen. Es handelt sich um Orte der Begegnung, die den sozialen Zusammenhalt fördern, als Treffpunkte für Jung und Alt dienen und dazu beitragen, den Ortskern lebendig zu halten. Die Subventionen für Gasthäuser und Bars sowie für Nachbarschaftsbetriebe im Ortskern sind daher durchaus nachvollziehbar. Die derzeitigen Förderkriterien sehen jedoch vor, dass nur solche Betriebe gefördert werden können, die in einem Umkreis von einem Kilometer keine anderen Betriebe haben. Das bedeutet, dass Orte, in denen sich außerhalb des Dorfkerns Gasthäuser oder Bars befinden, von der Förderung ausgeschlossen sind. Es besteht also Handlungsbedarf.
Es sei für kleine Orte ein großes Problem, erklärte Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit). In vielen Orten gebe es nach einem Begräbnis keinen Treffpunkt mehr. Dorfgasthäuser könnten auch die Post ausgeben und somit einen weiteren Dienst aufrechterhalten.
Madeleine Rohrer (Grüne) fand den Antrag sympathisch, die Dorfgasthäuser seien auch Orte der politischen Diskussion. Problematisch sei aber, wenn der Bürgermeister entscheiden könne, welche Gasthäuser bleiben könnten.
Sandro Repetto (Demokratische Partei) unterstützte den Antrag, es dürfe bei der Förderung nicht nur der wirtschaftliche Aspekt ausschlaggebend sein, sondern auch die soziale Bedeutung.
Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit) betonte, dass die Gasthäuser auch eine hohe Qualität hätten. Die Dorfgasthäuser hätten eine soziale Funktion, die aber vor allem in den Wintermonaten schwer aufrechtzuerhalten sei. Jeder Wirt mache sich seine Rechnung, wenn die Kosten zu hoch seien. Sie bräuchten Unterstützung, denn alleine könnten sie das nicht bewältigen.
Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) kritisierte, dass die Bürgermeister heute nicht mehr so streng seien bei den Lizenzen, wenn es darum gehe, dass trotz Urlaubsschließung wenigstens ein Betrieb im Dorf offenbleibe. Viele Wirte würden gleich am Tag nach Saisonsende schließen. Man sollte nicht so tun, als seien alle Samariter.
LR Luis Walcher erinnerte daran, dass er im September 2024 die Spielregeln für die Förderung geändert und damit wohl den Nagel auf den Kopf getroffen habe. Dorfgasthäuser seien auch wichtig, um die Abwanderung aufzuhalten. Der Antrag spiegle seine Grundgedanken sehr gut wider. Es habe zur Neuregelung auch Kritik und Anregungen gegeben, etwa zur Aufteilung der Beiträge oder zu den Betrieben am Dorfrand. Man habe die Priorität auf den Ortskern gelegt, gerade wegen der sozialen Funktion, und nun sei es auch möglich, Gasthäuser in Gebäuden der öffentlichen Verwaltung zu unterstützen. Man werde nun untersuchen, wie sich die neuen Kriterien auswirken und eventuell Anpassungen vornehmen. Wichtiges Kriterium sei, dass der Betrieb das ganze Jahr offenbleibt. Es sei auch zu bedenken, dass man mit der Förderung in den freien Markt eingreife.
Hannes Rabensteiner erkannte an, dass die bestehende Förderung nützlich sei, aber sie habe einige Schwachstellen. Das Problem bestehe vor allem außerhalb der Saison. Gar einige Betriebe seien von der Förderung ausgeschlossen worden, wenn es z.B. in der Umgebung eine Hotelbar gebe, die aber von den Einheimischen kaum genutzt werde.
Der Antrag wurde, in mehreren Abstimmungen zu den einzelnen Punkten, mehrheitlich abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 262/25: Autismus-Epidemie - Sofortige Maßnahmen erforderlich, um unsere Kinder, ihre Familien und die Zukunft der gesamten Bevölkerung zu schützen (eingebracht von der Abg. Holzeisen am 17.04.2025). Der Landtag möge die Landesregierung verpflichten, 1. in der Person des Landeshauptmannes der Regierungspräsidentin mit größter Dringlichkeit den Antrag zu übermitteln, sie möge mit größter Dringlichkeit, im Sinne von Art. 12 Gesetz Nr. 400 vom 23.08.1988, die Ständige Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und autonomen Provinzen zum Zwecke der sofortigen Aussetzung der Kinderimpfpflicht einberufen; 2. die der Autonomen Provinz Bozen zustehenden Kompetenzen unverzüglich zu nutzen, um de facto sofort die Umsetzung der pädiatrischen Impfpflicht zu vermeiden, indem der Südtiroler Sanitätsbetrieb angewiesen wird, den Vorrang des europäischen und des nationalen Arzneimittelrechts und somit die Verpflichtung zur ärztlichen Verschreibung zu respektieren, die von der Europäischen Kommission für jeden pädiatrischen Impfstoff im zentralisierten Beschluss über die Marktzulassung auferlegt wird, wobei die ärztliche Verschreibungspflicht per se jede Impfpflicht ausschließt; 3. dringend einen Krisenstab einzurichten, der sich ohne Tabus mit dem Problem der Autismus-Explosion in Südtirol befasst und auch die Vertreter der politischen Minderheit einbezieht; 4. eine offene, tabufreie wissenschaftliche Debatte und objektive Informationen ohne Zensur zum Thema der Autismus-Epidemie und seiner Ursachen zu fördern.
LR Achammer habe erst in einem Fernsehauftritt auf einen massiven Zuwachs bei den Autismus-Spektrum-Störungen hingewiesen, erklärte Renate Holzeisen (Vita). Allein an den italienischen Schulen gebe es im Vergleich zum Vorjahr 400 Diagnosen mehr. Bei einer Anhörung im Landtag hätten Schulkräfte erklärt, dass der Zuwachs nicht auf geänderte Untersuchungskriterien zurückzuführen sei. Man wisse, dass die Impfungen, die seit 2017 für Kinder Pflicht seien, nie in Placebo-Kontrollgruppen getestet worden seien. Man kenne daher nicht deren effektive Wirkung. US-Gesundheitsminister Kennedy habe erst darauf hingewiesen, dass Autismus vor allem in Ländern mit hoher Impfrate verbreitet sei. Nun habe er Kontrolltests zur Pflicht gemacht und für September eine Ursachenstudie angekündigt. Es gebe Studien mit Peer Review, die den Zusammenhang mit den Impfstoffen nachwiesen.
Franz Ploner (Team K) bestätigte, dass viele betroffen seien. Es gebe viele seriöse Studien zu den Ursachen, jene, die Holzeisen genannt habe, gehörten nicht dazu. Sie sollte, auch aus Respekt vor den betroffenen Eltern, aufhören, aus dem Autismus politisches Kapital zu schlagen. Wenn Eltern wegen Holzeisens Impfmärchen ihre Kinder nicht impfen ließen, dann trage sie auch Verantwortung dafür. Mit ihren Märchen zerschlage sie viel wertvolles Porzellan.
Anna Scarafoni (Fratelli d’Italia) vermisste das Vorsichtsprinzip in der gängigen Meinung. Es gehe um die Behandlung von Kindern, umso mehr sei Vorsicht geboten. Die Einführung der Kinderpflichtimpfungen 2017 sei eine politische Operation gewesen. Seitdem verzeichne man einen Anstieg der Autoimmunerkrankungen: Dermatitis, Morbus Cron, Zöliakie u.a. 14 europäische Länder hätten diese Impflicht für Kinder nicht, das werde einen Grund haben.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) bedauerte, dass man bei solchen Themen immer wieder unsachlich werde. Impfen habe in vielen Fällen Leben gerettet, aber es seien auch Nebenschäden verzeichnet worden. Es stimme, dass Autismusstörungen zugenommen hätten, und da seien die Ursachen zu ergründen. Das könne man ganz nüchtern machen, ohne das Thema zu ideologisieren.
Das Thema sei delikat und wichtig, erklärte Sandro Repetto (Demokratische Partei). Es sei richtig, sich damit zu befassen, aber auf der Grundlage der Wissenschaft. Zum Zusammenhang mit den Impfungen gebe es keinen wissenschaftlichen Konsens, er sei vielmehr durch viele Studien längst widerlegt. Die Impfungen würden Leben retten, auch das jener Kinder, die aus verschiedenen Gründen nicht geimpft werden könnten.
LR Hubert Messner wies auf die umfangreichen Anhänge zum Antrag hin, die hauptsächlich von der impfkritischen Organisation Children’s Health Defense stammten. Der Antrag sei polemisch formuliert und folge einer Logik der Vorverurteilung. Er gehe von Dingen aus, die wissenschaftlich nicht haltbar seien. Das Phänomen sei echt und ernst zu nehmen. Sicher sei, dass die Diagnostik schärfer geworden sei. Zugenommen hätten laut Experten vor allem die leichten Formen. Ursachen könnten Umwelteinflüsse - Schwermetalle, Pestizide -, perinatale Komplikationen oder genetische Faktoren sein. Der Zusammenhang zwischen Impfung und Autismus seien nicht erwiesen. Die Impfthese stamme von einer alten Behauptung, die zurückgezogen werden musste. Der Antrag sei aus medizinisch-wissenschaftlichen Gründen abzulehnen. Vielmehr sollte man mehr in Diagnostik und Betreuung investieren.
Der Großteil im Landtag verhalte sich also weiterhin verantwortungslos gegenüber den Kindern, bemerkte Renate Holzeisen. LR Messner verweise in seiner Antwort auf Studien, müsse aber einräumen, dass es keine Studien mit Kontrollgruppen gebe. In den USA, wo jetzt Meinungsfreiheit herrsche, werde es solche Studien geben. Außer für die italienische Schule habe die Landesregierung keine Zahlen zur Entwicklung vorlegen können. Stattdessen verabreiche man weiterhin experimentelle Impfstoffe mit Aluminium und schließe Ungeimpfte von Schule und Kindergarten aus. Auch Ploner habe mit seiner Stellungnahme die Fakten nicht widerlegt. Sie verweise auf Studien mit Peer Review von anerkannten Experten. Die Landesregierung wolle die Ursachen gar nicht ergründen.
Der Antrag wurde in mehreren Abstimmungen zu den einzelnen Punkten mehrheitlich (je 25 Nein) abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 266/25: Lehrberufe: Gehälter & Kaufkraft stärken (eingebracht vom Abg. Leiter Reber am 18.04.2025). Der Landtag verpflichtet die Landesregierung, 1. – dem Landtag innerhalb von 6 Monaten ein Konzept vorzulegen, mit welchem sie darlegt, wie die Gehälter und die damit verbundene Kaufkraft der Südtiroler Lehrberufe angehoben und mittelfristig die aktuell großen Unterschiede zu den Gehältern in den benachbarten Regionen ausgeglichen werden können. 2. - das überdurchschnittliche Engagement von Lehrkräften an herausfordernden Standorten mit heterogenen Klassenverbänden und großer Sprachkomplexität über eine eigene Landeszulage oder zusätzliche Benefits anerkennen zu wollen. 3. - Benefits, wie eine Dozentenkarte im Wert von jährlichen 500 – 1.000 Euro einzuführen, damit Südtirols Lehrkräfte sich besser mit technischen Hilfsmitteln und Softwareprogrammen ausrüsten, sich mit Fachliteratur und digitalen Abos weiterbilden und Fortbildungen auf Staatsebene sowie im deutschsprachigen Ausland besuchen können.
Die Gehälter der Lehrkräfte in Südtirol sind in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Vor 30 Jahren verdiente ein Lehrer nach 40 Dienstjahren rund 5.500 Euro, heute nur noch die Hälfte, bemerkte Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion). Trotz der Landeszulagen sind die Gehälter der Lehrkräfte in Südtirol im Vergleich zu den Nachbarregionen in Österreich, der Schweiz und Deutschland deutlich niedriger. Eine Statistik zeigt, dass die inflationsbereinigten Bruttoeinkommen im Bereich Schule und Erziehung heute um 37% geringer sind als 1995. Neben einer besseren Bezahlung sollen auch technische Ausstattung und Benefits wie die Dozentenkarte eingeführt werden, um die Rahmenbedingungen für Lehrkräfte zu verbessern. Schulen in ländlichen und urbanen Gebieten haben unterschiedliche Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Sprachkomplexität und Heterogenität der Klassen.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) wies auf die viele unsichtbare Arbeit der Lehrer hin, die auch immer mehr gefordert seien, denn die Schule solle heutzutage ja alles Mögliche leisten. Viele Lehrkräfte, aber auch andere Fachkräfte, würden nach Österreich, Deutschland oder in die Schweiz abwandern, weil es dort bessere Bedingungen gebe. Die Lehrer würden immer wegen ihrer Sommerferien beneidet, die längst nicht mehr so lange dauerten, sie könnten auch nicht mehr nach ein paar Jahren in Pension gehen. Den Lehrern würde auch die Schuld zugeschoben, wenn die Noten nicht passten.
Seit sie im Landtag sei, habe sie Debatten über die Lehrergehälter gehört, erklärte Maria Elisabeth Rieder (Team K), räumte aber ein, dass man in dieser Legislaturperiode etwas weitergekommen sei. Bis jetzt habe man aber nur eine Inflationsanpassung vorgenommen, man müsse Schritt für Schritt weitergehen. Es brauche vor allem eine Erhöhung des Grundgehalts, denn diese schlage sich auch auf die Pension nieder.
Alex Ploner (Team K) fragte, wann man nach Jahren der Diskussion endlich in die Gänge kommen werde. Während man die Zeit mit Diskussionen verschwende, gingen die Lehrer nach Österreich, in die Schweiz oder in die innere Emigration, mit Dienst nach Vorschrift. Hier habe die Landesregierung Handlungsbedarf, denn die Opposition fordere schon lange eine Lohnerhöhung.
Früher sei der Lehrer neben dem Pfarrer ein Leuchtturm im Dorf gewesen, bemerkte Brigitte Foppa (Grüne), heute sei er zum sozialen Feuerlöscher geworden. Alle müssten durch die Schule, und jeder gewünschte gesellschaftliche Fortschritt werde der Schule auferlegt. Umso mehr gäbe es gute Gründe, den Beruf aufzuwerten, wobei man nicht Gehalt gegen Benefits ausspielen sollte.
AM