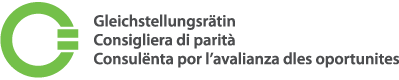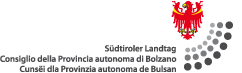News
Plenarsitzung - Raumordnungsverträge, Namensschilder, gemeinnütziger Wohnbau, Faktencheck
Anträge von Wir Bürger, Süd-Tiroler Freiheit, SVP und La Civica. Februar-Sitzung beendet.
Landesgesetzentwurf Nr. 23/24: Änderung des Buchstaben a) des Absatzes 3 des Artikel 20 - Landesgesetzes Nr. 9/2018 "Raum und Landschaft" (vorgelegt vom Abg. Colli am 17.05.2024).
Das neue Raumordnungsgesetz vom 2018 habe die Raumordnungsverträge wieder eingeführt, wenn auch mit Einschränkungen, erklärte Andreas Colli (Wir Bürger). Die Einschränkung, solche Verträge nur mehr für das abgegrenzte Siedlungsgebiet zu ermöglichen, sei zu eng. Es seien bereits genügend Sicherungen eingebaut, um Spekulationen zu verhindern. Von dem her sei auch das negative Gutachten des Rates der Gemeinden unverständlich. Man denke etwa an Wege oder Kreuzungen außerhalb des Siedlungsgebiets, die man neugestalten möchte, aber auch an neue Wohnbauzonen.
Josef Noggler (SVP) erinnerte daran, dass der Gesetzentwurf im Gesetzgebungsausschuss mehrheitlich abgelehnt wurde.
Raumordnungsverträge seien grundsätzlich ein begrüßenswertes Instrument, meinte Paul Köllensperger (Team K). Das Problem sei, dass das öffentliche Interesse schwer zu definieren sei. Das neue Raumordnungsgesetz sei ein schlechtes Gesetz, und dieser Vorschlag würde im Endeffekt wohl dazu führen, dass der Landschaftsschutz noch mehr geschwächt wird.
Der Meinung war auch Madeleine Rohrer (Grüne). Durch Collis Vorschlag würde noch mehr in der Landschaft gebaut, es gäbe noch mehr “kreative Urbanistik”.
Sie kennen einige Beispiele für gute Raumordnungsverträge, erklärte Waltraud Deeg (SVP), aber auch kritische Fälle. Daher sollte man innerhalb der Siedlungsgrenzen bleiben.
LR Peter Brunner erinnerte daran, dass zu den Grundsätzen des Raumordnungsgesetzes auch die Vermeidung von Zersiedelung gehöre. Collis Vorschlag gehe aber in Richtung Zersiedelung.
Er sehe in dieser Debatte viel Misstrauen gegenüber den Gemeinden, erklärte Andreas Colli, das sei aber nicht gerechtfertigt.
Der Gesetzentwurf wurde mit 6 Ja und 25 Nein abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 124/24: Dienstkleidung und Namensschild für Fahrer im öffentlichen Nahverkehr (eingebracht von den Abg. Zimmerhofer, Rabensteiner, Knoll und Atz am 27.07.2024).
Eine einheitliche Dienstkleidung würde zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls und zur Verbesserung der Sicherheit und Orientierung für Fahrgäste beitragen, meinte Bernhard Zimmerhofer (Süd-Tiroler Freiheit). Er nannte auch noch zusätzliche Maßnahmen, die sinnvoll wären: Zusätzliche Maßnahmen: Namensschilder für alle Bediensteten, ordentliche Ausbildung in Sprach- und Ortskenntnissen, Vermeidung ständig wechselnder Streckenzuweisungen, und spezielle Fahrkurse für Bergstraßen.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) nannte das Beispiel Schennas, wo es viele Touristen aus dem deutschsprachigen Raum gibt, die keine Informationen in ihrer eigenen Sprache erhalten und auch keine Ortsnamen oder Wegbeschreibungen kennen.
Früher seien die Busfahrer der örtlichen Bevölkerung gut bekannt gewesen, stellte Brigitte Foppa (Grüne) fest, das sei nicht mehr so. Es gehe hier um ein Konsumentenrecht, die Fahrgäste sollten wissen dürfen, mit wem sie es zu tun haben. Daher könne sie dem beschließenden Teil des Antrags zustimmen.
Die Busfahrer leisteten einen wichtigen und schwierigen Dienst, meinte Madeleine Rohrer (Grüne), und man sollte das anerkennen. Aber es wäre gut zu wissen, wer einen täglich zur Arbeit bringt.
Ein Namensschild wäre auch eine Wertschätzung, meinte Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion). Die Krankenhausmitarbeiter würden da mit gutem Beispiel vorangehen.
In zahlreichen anderen Berufen seien Namensschilder üblich, berichtete Myriam Atz (Süd-Tiroler Freiheit), etwa bei den Taxifahrern immer öfter auch bei den Kellnern.
Ein Namensschild sei im Krankenhaus seit 15 Jahren Pflicht, bemerkte Franz Ploner (Team K). Das sollte für den ganzen öffentlichen Dienst gelten. Ebenso sollten in Dokumenten wenigstens das Kürzel der Sachbearbeiter angegeben werden.
Sandro Repetto (PD) unterstützte den beschließenden Teil des Antrags. Der Fahrer habe auch die Rolle einer Amtsperson.
LR Daniel Alfreider wies ebenfalls auf die Unterschiede zwischen Antrag und Prämissen hin. Man unternehme viele Anstrengungen, um den Dienst kundenfreundlich zu machen und auch, um viele Strecken aufrecht zu erhalten. Das Schild mit Namen oder Matrikelnummer für den Busfahrer sei laut den Konzessionsverträgen bereits Pflicht. Das sei auch für die Kontrolle wichtig.
Bernhard Zimmerhofer fragte, warum die Pflicht bisher nicht umgesetzt wurde.
Die Prämissen des Antrags wurde mehrheitlich abgelehnt, der beschließende Teil wurde mit 13 Ja und 17 Nein abgelehnt.
Beschlussantrag Nr. 220/25: Gemeinnützigen Wohnbau fördern (eingebracht von der Abg. Deeg am 24.01.2025). Der Landtag möge die Landesregierung beauftragen, ergänzend zu den staatlichen steuerlichen Anreizen auch auf Landesebene die Einführung steuerlicher Anreize und Vergünstigungen zu prüfen, um die Schaffung von gemeinnützigen Mietwohnungen zu begünstigen.
Waltraud Deeg (SVP) wies darauf hin, dass es auch in Deutschland, zum Beispiel in Berlin, Schwierigkeiten auf dem Wohnungs- und Mietmarkt gibt: Das Problem ist nicht mehr, bezahlbaren Wohnraum zu finden, sondern nur noch eine Wohnung zu finden. Die Situation in Südtirol, wo 70 Prozent des Wohnungsbestands Eigentum sind, wird mit Bewunderung betrachtet. Eine Lösung für die aktuellen Probleme könne der gemeinnützige Wohnbau sein, der in Österreich stark verbreitet sei, vor allem in Wien. Der gemeinnützige Wohnbau bietet bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsgruppen und verfolgt soziale Ziele statt Profitmaximierung. Mietpreise orientieren sich an gesetzlichen Vorgaben oder tatsächlichen Kosten und sind oft durch staatliche Fördermittel unterstützt. Gewinne werden reinvestiert, um langfristig erschwinglichen Wohnraum zu sichern. Moderne Projekte legen Wert auf Nachhaltigkeit und architektonische Qualität. Herausforderungen bestehen in der finanziellen Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln und dem Konkurrenzdruck durch private Entwickler. In Südtirol könnten solche Projekte mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Das große Potenzial läge aber auf staatlicher Ebene mit deutlichen steuerlichen Anreizen. Die derzeitigen Anreize seien aber mit dem Eigentum verbunden, die Genossenschaften würden nicht berücksichtigt.
Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) fragte, welche steuerlichen Vergünstigung das Land bieten könne. Es gebe nicht viele Landessteuern. Eine Möglichkeit wären die zinslosen Darlehen, aber entsprechende Vorstöße seien von der Mehrheit stets abgelehnt worden.
Sandro Repetto (PD) nannte als Beispiel die Kasernenareale, die man in diesem Sinne nutzen könnte. Auch er bat um mehr Angaben zu Steuererleichterungen durch das Land.
LH Arno Kompatscher kündigte an, dass im anstehenden Wohnbauomnibus bereits einige Dinge zum gemeinnützigen Wohnen enthalten seien. Man werde nun genau prüfen, wo das Land Steueranreize bieten könne, bei GIS, Irap u.a. Günstige Darlehen würden im Gesetz auch angesprochen. Diese seien angesichts der heutigen Zinssätze wieder interessant.
Waltraud Deeg betonte, dass sie sich nicht gegen das zinslose Darlehen ausgesprochen habe. Es sei bereits im Wohnbaugesetz verankert, sei aber lange Zeit nicht genutzt worden. Es stehe aber in Konkurrenz zum Bausparmodell. Das Wobi könnte mehr in den Wohnbau investieren, wenn es keine GIS zahlen müsste; damit müsste man mit den Gemeinden reden. Die Kasernen seien die interessanten Wohnbauflächen der Zukunft in den Städten.
Der Antrag wurde mit 32 Ja einstimmig angenommen.
Begehrensantrag Nr. 33/25: Beibehaltung des Faktenchecks in Sozialen Netzwerken (eingebracht von Abg. Stauder und Gennaccaro am 24.01.2025). Der Südtiroler Landtag das italienische Parlament und die italienische Regierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die Europäische Kommission und das Europäische Parlament, 1. den Digital Services Act konsequent umsetzen, 2. Faktenchecks auf Social-Media-Plattformen vorschreiben und diese nicht an private Organisationen ausgelagert werden können.
Er habe auch heute beim Besuch einer Schülerklasse gesehen, dass sich Jugendliche vor allem über soziale Netzwerke informieren, berichtete Harald Stauder (SVP).
Angesichts der zunehmenden Verbreitung von Desinformation und Fake News sei die Bedeutung von Faktenchecks zur Sicherung des Wahrheitsgehalts von Informationen groß. Es gehe um wissenschaftliche Überprüfung, nicht um Zensur. Stauder verwies auch auf die Entscheidung von Meta, die Zusammenarbeit mit externen Faktenprüfern zu beenden, und warnte vor den negativen Auswirkungen auf die demokratische Entwicklung. Der Digital Services Act der EU wird als wichtiger Rahmen zur Bekämpfung illegaler Inhalte und zum Schutz der Meinungsfreiheit hervorgehoben.
Wenn man Falschinformationen verhindern wolle, sollte man im Landtag anfangen, erklärte Jürgen Wirth Anderlan (JWA), dort habe er von Remigration gesprochen, und das sei ihm als Deportation ausgelegt worden. Stauder habe 2023 Jugendliche mit Migrationshintergrund als soziales Problem bezeichnet. Er fragte, ob auch das Hassrede sei. Die Mehrheit zeige sich wieder unfähig und wisse nicht mehr wohin.
Sandro Repetto (PD) sah die Äußerungen von Zuckerberg und Musk kritisch. Die Forderung des Antrags sei utopisch in einem Land, das zusammen mit der Partei der Musk-Freundin Meloni regiert werde. Er werde dafür stimmen, glaube aber wenig an den Erfolg.
Dies sah auch Zeno Oberkofler (Grüne) so. Das Vorhaben sei heuchlerisch, solange die Trump-Fans in der Landesregierung säßen. Er werde für den Antrag stimmen, verlange aber mehr Ehrlichkeit. Die einzige Hilfe gegen Trump sei ein geeintes Europa, nicht ein Europa der populistischen Nationalisten.
Sven Knoll (Süd-Tiroler Freiheit) meinte, Musk und Zuckerberg würden jetzt zittern, wenn der Landtag etwas über sie etwas beschließe. Er sah auch einen Widerspruch in dem Antrag und erinnerte daran, dass ein Landeshauptmannstellvertreter jüngst mit Casapound mitmarschiert sei. Fake News gebe es bereits im Landtag genug, etwa bei den Stellungnahmen der Landesregierung. Es sei auch die Frage, wer entscheide, was Fake News seien. Klassische Medien wie Zeitungen seien auch nicht die Hüter der Wahrheit, das seien Meinungen einzelner Journalisten. Die Bevölkerung könne sich selbst ein Bild machen, was Wahrheit und was Lüge sei.
Paul Köllensperger (Team K) kündigte Unterstützung für den Antrag an, sah aber auch die Widersprüche. Leute wie Musk forderten Meinungsfreiheit, meinten aber einen Freibrief für Propaganda durch Fake News.
LH Arno Kompatscher betonte, dass keine Eingriffe in die Meinungsfreiheit gemeint seien. Es gehe um den Abgleich von Meldungen mit dem Stand der Wissenschaft. Diese Checks machten Sinn, denn nicht alle seien Experten, um den Wahrheitsgehalt einer Meldung zu überprüfen. Faktenchecks würden heute in einem Hinweis bestehen, dass eine Nachricht möglicherweise nicht faktengestützt sei, nicht dem Stand der Wissenschaft entspreche. Da würden keine Inhalte gelöscht. Er sehe es als sinnvoll, wenn auch der Landtag hier eine Position einnehme.
Harald Stauder (SVP) wehrte sich gegen den Vorwurf Wirth Anderlans, er sollte, wenn schon, richtig zitieren. Der Antrag werde die Welt nicht ändern, aber es sei gut, wenn man zeige, wofür man stehe. Es gebe heute noch viele Menschen, die an eine flache Erde glaubten.
Der Antrag wurde mit 23 Ja, 5 Nein und 2 Enthaltungen angenommen.
Damit war die Tagesordnung erschöpft. Der Landtag tritt im März wieder zusammen.
AM